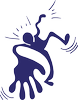10. Reisebericht, März 2006 Oman – Eritrea
Im Grossen und Ganzen ist der Besuch nach Ankunft in einem Lande bei der Einwanderungsbehörde, beim Zoll und Hafenpolizei eine Geduldssache, die ich grosszügig Andi überlasse. Seit Indonesien wurden wir in fast allen Ländern kräftig zur Kasse gebeten.
Das heisst dann „Cruising Permit“ (Bewilligung zum Befahren der Hoheitsgewässer), Hafengebühr, Gebühr zur Bewilligung zum Landgang, einfach so eine Gebühr pro Person oder was man sich sonst so einfallen lassen kann. Manche Gebühren kann man ja noch nachvollziehen, bei anderen ist es unverhältnismässig hoch oder jegliche nachvollziehbare Leistung fehlt. Zumeist buchen wir diese Ausgaben für uns als „Entwicklungshilfe für das Land“ ab. In Oman ist die Bezahlung aller Gebühren in der Höhe von ca. CHF 120 insofern schwierig, da sie in der Landeswährung Rial sofort bezahlt werden muss. Rials könnten wir problemlos am Bankautomaten vor dem Hafenareal beziehen, aber niemand darf den Hafen ohne vorherige Bezahlung der Gebühren und ohne Erhalt des damit verbundenen Hafenpasses verlassen. Also bräuchte man einen Agenten, der die Gebühren für eine Servicegebühr von US$ 100 vorschiesst, alternativ helfen die Segler sich gegenseitig aus. Für uns wird das alles noch komplizierter, da wir unsere einzige gültige Bankkarte für den Bargeldbezug vermissen und Kreditkarten von den hiesigen Banken nicht akzeptiert werden. Trotz allem können wir von Freunden den Vorschuss für die Gebühren sowie genügend Geld für Telefon und Taxi leihen, um unsere Karte, die wir wohl vor drei Wochen in Sri Lanka verloren haben, zu sperren und einen Geldtransfer zu veranlassen.
Zum Hafenausgang geht es etwa ein Kilometer auf einer betonierten, staubigen Strasse entlang. Das Gemurre der Kinder über diese Fusswege ist uns jedesmal sicher, aber wir werden fast immer von einem Hafenarbeiter mit seinem Auto oder von einem LKW mitgenommen. Kurz vor dem Hafen-Kontrollpunkt müssen wir aussteigen und werden von der Wache ins Büro seines Chefs eingeladen. Auf dem Weg über die luxuriöse Granittreppe bemerke ich, dass Andi die Hose verkehrt rum anhat. Während die eifrigen unformierten Beamten unsere Pässe und Bewilligungen kontrollieren, zieht Andi unbemerkt seine Hose vor den Amtsträgern aus und richtig rum wieder an! Hätten die einmal über ihren hohen noblen Empfangstisch geguckt. Endlich stehen wir draussen am Taxistand. Sofort umringen uns eifrige Taxifahrer in ihren langen weissen Röcken und ihrer traditionellen reich bestickten moslemischen Kopfbedeckung (Kumma). Die ersten langen Minuten lassen wir sie untereinander darum diskutieren, wer uns nun in die Stadt fahren darf. Anschliessend feilschen wir mit dem Gewinner um den Fahrpreis. Unser Fahrer sieht für uns sehr exotisch aus: Ein hennagefärbter oranger Vollbart umrahmt sein braunes, kantiges Gesicht. Er ist um die sechzig Jahre, trägt einen weissen langen Rock und einen Turban unter dem sich seine grauen Haare hervor krausen. Er möchte 15 Rial (1 Rial = ca. 3.20 CHF) für die einfache Fahrt in die Stadt, wir wollen (wie andere Segler) für drei Rial gefahren werden. An der offiziellen Tafel steht ein Preis für 8 Rial angeschrieben. Je länger man Zeit hat zu feilschen, desto günstiger fällt der Preis aus. Die Sonne brennt erbarmungslos auf uns nieder. Alle Taxifahrer reden fleissig drein. Schliesslich schlägt unser Fahrer vor, einfach mal einzusteigen, den Preis werden wir schon noch ausmachen. Für uns ist das unüblich und schmeckt nach späteren Diskussionen. Gerne würden wir nun im Taxi den Preis aushandeln. „Lassen sie sich Zeit, wir reden später darüber!“ meint der Taxifahrer. Langsam kommen nach den ausgewechselten Höflichkeiten die Verhandlungen in Gang. Mushalla, so ist sein Name, schlägt uns eine vierstündige Fahrt durch Salalah inkl. Rückfahrt für acht Rial vor, inklusive aller gewünschter Stationen wie Telefonkarte kaufen, DHL Büro, Supermarkt und zudem will er uns einen Überblick von Salalah vermitteln. Das finden wir einen fairen Handel. Wir rufen in die Schweiz an, lassen unsere Konten kontrollieren und stellen erleichtert fest, dass sich niemand unrechtmässig bedient oder bereichert hat. Dann lassen wir uns teure Dollars über Western Union überweisen. Es ist angenehm, einen freundlichen ortskundigen Führer zu haben.
Zur Mittagszeit bringt er uns zu einem typisch omanischen Restaurant, das bei den Einheimischen beliebt ist. Es riecht nach Weihrauch. Wir stehen in einem engen dunklen Gang. Nirgends sind Tische und Stühle zu sehen. Der Kellner führt uns zu einer der vielen Türen und gibt uns zu verstehen, dass wir unsere Schuhe ausziehen sollen. Unser „Privat-Zimmer ist mit dicken Sofa-Polstern ausgestattet. Auf dem Teppich liegt eine Plastikfolie. Toll, uns gefällt’s. Abgesehen davon, dass der Kellner gleich noch eine Seifenoper im Fernseher einstellt. Aber wenn das dazu gehört, drücken Andi und ich ein Auge zu. Die Gerichte auf der Karte klingen interessant. Wir haben keine Ahnung, um was es sich handelt und lassen den Kellner seine Empfehlungen servieren. Bald haben wir Berge von Speisen auf grossen Tellern zu unseren Füssen liegen. Es würde gut noch einmal für eine hungrige, fünfköpfige Familie reichen. Gelber Reis mit Gewürzen, Weintrauben und Huhn, ein weiterer gelber anders gewürzter Reis ohne Weinbeeren mit ein wenig Gemüse, Fladenbrote, Joghurtsossen, Salate, Curry-Huhn, Sossen zum Eintunken, Lammfleisch gegrillt und sogar Pommes frites schmecken herrlich. Anschließend versinken wir alle schlapp und vollgefressen im Sofa. Fehlte nur noch eine Wasserpfeife. Der süsse schwarze Tee hilft uns etwas, nicht ganz einzuschlafen. Wir müssen uns wieder weltlichen Dingen, wie z.B. einkaufen, zuwenden. Einen ortskundigen Führer zu haben, finde ich meist kurzweiliger und zeitsparender als auf eigene Faust zu entdecken. Erfahrungsgemäss erhalten wir so mehr Geheimtipps, Hintergrundinformationen und Kontakt zu Einheimischen. Aber für den Preis einer einfachen Taxifahrt ins Zentrum von Salalah mieten wir einen schönen weissen Mietwagen. Andi hat seinen Führerausweis nicht dabei, also gelte ich als Fahrerin. Fabien meint zweifelnd: „Mami kannst du überhaupt Auto fahren?!“ Soweit ist es also schon gekommen, höchste Zeit auch mal an Land das Steuerrad zu übernehmen!
Unsere erste Fahrt führt uns nicht gleich in die Wüste, sondern zum noblen grossen Hotel Crown Plaza direkt am Strand. Den Strand wollen wir ja gar nicht geniessen, nur die grosse Pool-Anlage mit Rutschbahnen und die tolle Duschanlage! Ab in die Wüste Richtig los mit Entdeckungsfahrten geht es am nächsten Tag. Endlos scheint die schnurgerade Strasse durch die steinige Wüste zu führen. Entlang weiten verlassenen Sandstränden, hinauf durch die „Täler“, die hier Wadi genannt werden und sich bei Regen in reissende Flüsse wandeln. Wir fahren hinauf auf windige Anhöhen und wieder hinunter in die steinigen Ebenen. Ab und zu trampeln gemächlich Kamele über oder entlang der Strasse. Dann stellen die Omanis die Warnblinkanlage ihres Autos ein und drosseln auf Schritttempo. Als ich meine Warnblinkanlage bei einer kleinen Karawane an stelle und wir den Kamelen zu schauen, halten alle folgenden Autos und bieten uns ihre Hilfe an. Wir wollen die Oase Mudday etwa 200 km im Norden besuchen. Es gibt wenige Hauptstrassen und nur eine in Richtung Westen mit einer grossen Abzweigung nach Norden. Nach etwa zwei Stunden Fahrt liegt vor uns ein Kontrollpunkt der Armee. Oder sind wir gar schon an der Grenze zu Jemen? Haben wir die Abzweigung verpasst? Alle Papiere werden von ernsten Soldaten in dicken grauen Filzmänteln kontrolliert, dann dürfen wir den Kontrollpunkt passieren. Die Fahrt geht weiter durch die endlos scheinende Wüste. Verfahren kann man sich in Oman kaum. Trotzdem werden wir nach kilometerlanger Fahrt auf der geraden Strasse unsicher, ob wir nicht doch die Abzweigung nach Norden verpasst hätten. Endlich taucht ein Haus auf mit ein paar Männern, die davor schwatzen. Wir erkundigen uns nach der Abzweigung. Nur noch einen halben Kilometer weiter, dann würde es nach Norden gehen, sagen sie. Damit wir aber ganz sicher nicht verloren gehen, springen fünf Männer in ein Auto und fahren vor uns her. Bei der Abzweigung verabschieden sie sich mit Winken, guten Wünschen und viel Gehupe von unseren Begleitern. Wir fahren weiter durch die windige Einsamkeit der Wüste. Bei der nächsten Abzweigung führt eine Schotterstrasse in die Öde. Das kann ja nicht die Hauptstrasse nach Norden sein! Wir bleiben auf unserer gut geteerten, breiten Strasse. Nach nur einem halben Kilometer stehen wir vor den hohen verschlossenen Toren einer bestens gesicherten Militäranlage. Hier gibt es kein Durchfahren. Der Weg nach Norden führt offensichtlich über die Schotterpiste. Können wir es wagen, auf der Schotterstrasse in die Wüste zu fahren? Im Kofferraum führen wir fünf Liter Wasser und Essen mit. Bei einer Panne könnten wir noch einige Zeit überleben. Also fahren wir los.
Über Löcher, Steine und Sand holpern wir nun für die nächsten 70 Kilometer. „Wow, ein riesiger Spielplatz liegt hier mitten in der Wüste!“ begeistern sich unsere drei Jungs wenig später. Tatsächlich gibt es einen Militär-Trainingsplatz mitten in dieser heissen staubigen Einöde. Bei der nächsten Abzweigung sind wir ratlos, sollen wir rechts oder links weiter fahren? Wir entscheiden uns einstimmig für rechts und die holprige Fahrt geht weiter, vorbei an Steinen in allen Farben und Schattierungen. Hinter uns nähert sich eine Staubwolke. Ein Jeep überholt uns und verschwindet am Horizont. Sicher ist auch er auf dem Weg nach Mudday. Das mittlere Tempo liegt bei etwa 40 km/Std. über diese Piste aus Sand und Geröll. Langsam verspüren wir Hunger, aber wo sollen wir in dieser heissen Einöde picknicken? Wie weit ist es wohl noch bis zur Oase Mudday? Wir entscheiden uns im Schatten eines Felsvorsprunges eine Rast einzulegen. Zwischen Felsbrocken durch manövriere ich unser staubiges Auto möglichst nah in den Schatten. Der laute Automotor ist aus, die Holperei vorbei, Stille umfängt uns. Es ist schön hier. Es gefällt besonders den Kindern zwischen den Felsen herum zu kraxeln. Sie haben tolle Kristalle, Feuersteine und Versteinerungen gefunden und beladen unser Auto schwer damit. Nur fünfzehn Minuten weiter von unserem Picknickplatz taucht die Oase Mudday auf. Eine Autoreparaturstätte nach der anderen säumt die Strasse. Wir halten an einem Saftladen und Restaurant an und genehmigen uns kühle Drinks. Beim Anblick der am Nebentisch aufgetragenen Speisen bekommen wir trotz des vorherigen Picknicks gleich wieder Appetit und lassen Huhn und Reis auftragen. Auf unserer Strassenkarte ist in Mudday eine Tankstelle eingetragen. Bei der Dorfjugend, die mit lauter Musik um einen Jeep rumhängt, erkundigen wir uns nach dieser Tankgelegenheit. Sofort steigen alle in den Jeep, winken uns zu folgen und fahren mit lautem Gehupe und Gejohle 50 m weiter vor ein unscheinbares kleines Haus. Kanister mit Benzin werden heraus geschleppt, eine Handpumpe installiert und manuell in den Tank gepumpt. Das müssen wir natürlich fotografieren, was nicht ganz einfach ist, da sich jeder der Burschen, gut gekleidet in ihren Tunikas mit einer schön bestickten Kumma oder dem elegant um den Kopf geschlungenem Turban, sofort vor die Linse posieren. Das freut mich natürlich, das gibt tolle Fotos. Wo sind eigentlich die Frauen? Ab und zu sieht man eine schwarze Stoff-Wolke auf den Strassen dahin eilen. Die meisten Frauen sind ganz schwarz verschleiert, nur die dunklen mit Kohlstrich betonten Augen sind manchmal zu sehen. Andere Frauen sind mit farbigen Tüchern gekleidet, nur wenn sie älter sind, ist das Gesicht frei, geschmückt mit Gold an Nasenflügeln und Ohren. Übrigens bin auch ich speziell und schön bekleidet. Ich habe mir nämlich in Sri Lanka aus feiner blauer Seide mit Goldstickerei eine Tunika und weite lange Hosen nach indischer Art nähen lassen. So bin ich nicht nur angemessen bekleidet, sondern auch elegant, praktisch und sehr angenehm Zwei der Burschen, Mohammed und Said, möchten uns unbedingt zum Schwimmen in der Oase einladen. Tatsächlich gibt es einen grossen, gestauten Pool mit schlammigem Wasser, der uns allerdings nicht zum Schwimmen geeignet scheint. Wir klettern hinauf zu einer steilen Felswand und sind überrascht davon, wie viel klares kühles Wasser aus einem kargen Felsen in dieser trockenen Einöde sprudelt! Dattelpalmen wachsen üppig an dieser Quelle und spenden lauschigen Schatten. Said führt uns weiter zum jetzt unbewohnten „Haus“ seines verstorbenen Grossvaters. Das „Haus“ ist fast wie ein Iglu aber aus Steinen aufgeschichtet. Drinnen ist es karg, ein paar Bretter dienten wohl als Gestelle und Matten als Schlafstelle. Heute leben die Menschen hier in modernen weissen und meist sehr neu aussehenden Häusern. Unser Weg nach Salalah ist noch weit, leider müssen wir uns verabschieden. Wieder geht es über die Schotterstrasse, unterbrochen von neu geteerten Abschnitten. Kamele überholen uns zusammengepfercht sitzend auf der Ladefläche eines Lasters und gucken neugierig umher! Bald sind wir im Ort Thumrait, das an der Hauptverkehrsstrasse zur Hauptstadt Omans „Muscat“ liegt. Eine grosse Tankstelle liegt in einem neuen modernen Gebäudekomplex und auch sonst sehen hier alle Häuser sehr neu und modern aus. Auf dem Weg nach Süden fahren wir der Hinweistafel nach zum Weltkulturerbe „Weihrauchbäume“ auf eine Anhöhe. Von dort sieht man auf die unten in der Ebene wachsenden knorrigen Weihrauchbäume. Wir wollen sie uns gerne aus der Nähe ansehen und klettern über die kristallinen, staubig-gelben Felsen hinunter. Weihrauch, das Harz dieser Bäume war Tausende von Jahren neben Gold eines der wertvollsten „Export“-Güter. Zu Gast bei den Beduinen Am Horizont sind wieder die Steinhügel mit den Wadis zu sehen, hinter denen Salalah (was übrigens „aufgehende Sonne“ heisst) liegt.
Die Sonne geht leuchtend orange langsam am Horizont unter. Kamelhirten treiben eine grosse Kamelherde zu ihren Zelten. Wir halten bei den Zelten an, um ein paar Fotos zu schiessen und uns ein wenig neugierig umzusehen. Sofort werden wir willkommen geheissen. Nein, die hinter einer Beduinen-Maske und Schleier versteckte Frau will keinesfalls fotografiert werden. Aber die wenigen englisch sprechenden Männer melken extra frische Kamelmilch für uns und bieten sie noch lauwarm mit viel Schaum in einer weiten Metallschale an. Sie schmeckt wunderbar! Ein erst eine Woche altes Kamelbaby erhält Stutenmilch mit der Babyflasche. Ich darf heute das Kamelbaby damit füttern, so ist auch das Fotografieren kein Problem. Der Geruch von Weihrauch liegt in der Luft. Die Männer rollen ihre Gebetsteppiche nach Mekka ausgerichtet aus, beten und singen. Wir lauschen dem eindrücklichen Schauspiel und den fremd klingenden Lauten. Abenteuer Diesel tanken Die Fahrt ist nur noch kurz auf der Autobahn nach Salalah. Unterwegs füllen wir unsere mitgeführten Dieselkanister an einer Tankstelle. Am Kontrollpunkt in den Hafen werden wir gleich freundlich durch gewinkt. Unten am Pier winkt uns ein Inder. Er sei Koch hier im Hafen und ihm gefalle mein schönes indisches Kleid. Wir palavern ein wenig mit ihm, währenddessen das Auto der Brandwache hinter unserem Auto hält. „Was haben sie in diesen Kanistern?“ fragt er herausfordernd. „Diesel „, antworten wir. „Es ist strengstens verboten, Diesel in das Hafenareal zu bringen. Ich muss sie per Funk bei meinem Boss melden.“ Unsere Kinder kommen halbverschlafen aus dem Auto gekrochen und wollen schleunigst ins Bett auf der „Muscat“. Wir müssen aber auf den Boss warten. Endlich kurvt rassig das Auto der Hafensicherheit mit dem Boss heran. „Es ist verboten Brennstoffe ins Hafenareal zu bringen!“ erklärt auch er. „Wo und wie können wir denn Diesel erhalten? Bei den Tankschiffen wollten wir eine Sammelbestellung für alle zwanzig hier liegenden Segelschiffe aufgeben, trotzdem ist die Menge noch zu klein, um beliefert zu werden.“ „Ich müsste Sie der Hafenpolizei melden“, meint der Boss dienstpflichtig. „Aber das gibt nur Probleme für Sie, mich und den Kontrollpunkt am Hafeneingang. Das lösen wir besser alleine. Kommen Sie morgen ins Büro, damit wir Ihnen für weitere Fahrten eine Bewilligung geben können. Dann ist das alles kein Problem mehr.“
Bevor wir am nächsten Morgen die östliche Tagestour starten, fahren wir mit einem Begleiter zum Büro der Hafenpolizei ausserhalb der Hafenanlage um „schnell“ die Bewilligung einzuholen. Leider weiss er nicht genau, was wir wollen und fühlt sich nicht zu ständig. Wir sollen im Hafen die Administration aufsuchen. Dort wollen sie von einer Bewilligung nichts wissen und weisen uns zum Büro für Brennstofflieferungen den Berg hinauf. Diese liefern aber keine kleinen Quantitäten, erst ab 10’000 Litern. Spätestens jetzt ist mindestens unser Begleiter mürrisch und ungeduldig. Wir werden noch zu zwei weiteren Orte geführt, bevor wir wieder im Büro des Hafenchefs landen. Eine Diskussion entbrennt über den Sinn und Unsinn darüber, dass wir ein paar Kanister schwer brennbaren Diesel nicht an Bord schaffen dürfen, aber die Möglichkeit hätten, einen Agenten für viel Geld zu beauftragen, die gleichen Kanister an einer Tankstelle zu füllen, um sie uns in seinem Personenwagen an den Pier bringen zu lassen, wo wir sie wiederum per Dingi auf die „Muscat“ bringen und von Hand einfüllen. Schliesslich schreibt uns der Herr eine Bewilligung für die Einfuhr von 400 Litern Diesel auf unsere Verantwortung, die wir unterschreiben müssen.
Ausflug nach Taquah und Mirbat
Verspätet starten wir zu unserer Halbtagestour, diesmal Richtung Osten der Küste entlang ins Städtchen Taquah mit mindestens fünf Festungen auf den umliegenden Hügeln und einer Burg mit Museum im Zentrum, so steht es jedenfalls im Reiseführer. Die Burg können wir nicht finden, also rattern wir über die steinige Strasse hinauf zu einer Festung mit grandioser Sicht auf das Städtchen. Die Festung mit ihren dicken Mauern sieht alt aus, welche Überraschung als wir ein unbrauchbares WC mit Wasserspülung finden, das unbestritten aus neuerer Zeit stammt. Wir erklimmen Steintreppen hinauf zur Zinne und schliesslich noch eine hölzerne Treppe ganz hinauf in den Turm. Ein Personenwagen hält vor „unserer“ Burg und eine omanische Familie steigt aus. Die Frau ist wie hier üblich schwarz verschleiert, aber ganz unüblich ist ihr Gesicht frei und sie ruft uns zu unserer grossen Überraschung ein lautes „Hello, how are you!“ zu. Sieht man doch kaum Frauen hier und schon gar keine, die uns so laut und herzlich auf englisch anspricht. Bevor ich aber ein kleines Gespräch starten kann, sitzt die ganze Familie schon wieder im Auto und braust über die steinige Strasse davon. Wieder zurück auf der Hauptstrasse nach Osten kommen wir in Mirbat an. Die alten Handelshäuser im Stadtkern stammen sind über 200 Jahre alt und aus der alten Zeit des Weihrauchhandels. Sie sind einfach aus Steinen gebaut mit Lehm und Farbe verputzt und mit Zinnen und feinen Zeichnungen an den Hauswänden bescheiden verziert. Die kleinen Fenster sind mit bunten Rolläden verschlossen. Leider ist der ganze Stadtkern sehr zerfallen, wie auch die alten Kanonen, die auf das Meer ausgerichtet sind.
Es ist höchste Zeit, uns nach einem Restaurant für das Mittagessen umzusehen. Nun, ganz so nett sieht das gefundene zwar nicht aus, eher wie ein grosses Fast-Food-Restaurant, dafür scheint es sauber zu sein. Es würde uns nicht wundern, wenn hier gar Hamburger und Pommes serviert werden. Der junge Wirt freut sich sehr darüber, exotische Gäste zu bewirten und tischt uns Riesenmengen an feinen arabischen Leckereien auf. Unmöglich, dass wir das alles aufessen können. Wir fragen, ob er uns den übrig gebliebenen Riesenberg des gelben Reis mit Weinbeeren und Gemüse gekocht, einpacken könnte. „Das kommt gar nicht in Frage“, meint er und schüttet das ganze gute Essen zu den Essensresten. „Ich verpacke ihnen eine neue Portion, die sie mitnehmen können“. Wir wehren ab, aber da ist nichts zu machen. Er gibt uns eine grosse Portion Reis mit und gleich noch eine Portion eingelegtes Gemüse, das ich eben so gern hätte. Die Nachmittagssonne brennt heiss vom Himmel. Auf dem Wege zurück Richtung Salalah fahren wir an hohen Sanddünen vorbei, die wir trotz der Nachmittagshitze erklimmen wollen. Wir toben uns in diesem überdimensionalen Sandhaufen so richtig aus, legen Spuren und verstecken uns in den Mulden. Yanik, Fabien und Floris rennen eine grosse Düne bis zum Meer hinunter und stellen erst nachher fest, wie steil der Rückweg ist! Andi spaziert zu unserem geparkten Auto zurück und will uns an der Strasse wieder treffen. Wir sausen noch ein wenig im Sand rauf und runter bevor wir die hundert Meter zu Hauptstrasse hinüber laufen. Am Strassenrand warten wir auf Andi. Jedes Auto das vorbeifährt, verlangsamt das Tempo um bietet uns eine Mitfahrgelegenheit an. Ja, es muss wirklich ein ungewohntes Bild sein, hier in der Wüste eine europäische Frau mit drei kleinen Kindern alleine am Strassenrand stehen zu sehen. Ein kurzer Abstecher über mit Felsbrocken Schotterstrassen führt uns zu den idyllisch auf einem Hügel über einer grünen, vogelreichen Lagune am Meer.
Samaram war bis etwa zum ersten Jahrhundert vor Christi Geburt ein bedeutender Hafen für den Export von Weihrauch. Kamelkarawanen brachten das kostbare Gut aus der Wüste, das hier auf die Schiffe umgeladen wurde. Lange war der Ort vergessen und unter dem Sand vergraben. Heute wird es als Weltkulturerbe restauriert und für Touristen zugänglich gemacht.
Ernste Piratengefahr auf dem Weg nach Afrika
Ein grosser, stolzer Dreimaster kommt mit vollen Segeln auf uns zu! Enterhaken haken sich in unserer Reling fest! Mutig und kraftvoll bekämpfen wir freche starke hart kämpfende Piraten mit unseren Schwertern, Knallfröschen und Leuchtraketen bis sie verletzt und müde aufgeben! Grosszügig bieten wir den Geschlagenen unsere Freundschaft an. Die Piraten schenken uns zum Abschied eine alte mit Juwelen und Gold gefüllte Schatztruhe…
Schade, dass die Realität anders aussieht als in den Träumen unserer Leichtmatrosen. Heute fahren Piraten oft schnelle moderne Motorboote und schiessen womöglich mit Waffen wild um sich. Im Ernstfall gäbe es allenfalls noch die Chance, gleich selber alle elektronischen Geräte im Schiff zu demontieren und sie anstandslos den Piraten zu übergeben. Damit könnte man sich vielleicht das Leben retten. Auf jeden Fall wäre es so oder so ein traumatisches Erlebnis, auf das wir gerne verzichten. Auf dem Weg von Oman, der Küste entlang von Jemen und Somalia sowie in der Meerenge Bab el Mandab (Horn von Afrika) ist die Piratengefahr unbestritten ernst zu nehmen! Auf dieser Strecke sind die 300 Seemeilen vor Jemen besonders gefährlich. Also, was können wir unternehmen, um möglichst unscheinbar und schnell diese gefährlichste Zone zu passieren? Ist es vorteilhafter alleine zu segeln oder sollen wir uns einem Konvoi anschliessen? Im Konvoi segeln mehrere Yachten nahe zusammen. Jeder Funkkontakt untereinander wird vermieden oder kurz mit dem Codewort „Switch Switch“ auf einer geheimen Frequenz angekündigt, um danach sofort auf den Kurzwellenfunk (SSB) auf die in Salalah vereinbarte Frequenz umzuschalten. Besonders nachts überwachen wir abwechslungsweise die nähere Umgebung mit dem Radar. Sollte sich ein unbekanntes Schiff mehr als eine Seemeile annähern, den Funkaufruf nicht beantworten und der Aufforderung sich zu entfernen nicht nachkommen, würden alle möglichen Notrufe abgesetzt werden. Das heisst auf allen Schiffen werden die verfügbaren Seenotrufbarken aktiviert, über E-Mail, Satellitentelefon (bei uns nicht vorhanden), Notruffrequenz auf SSB und Mayday oder PanPan Ruf über UKW abgesetzt. Und alle Yachten halten den vereinbarten Kurs und fahren mit mindestens 6.5 Knoten davon. Ja, und wenn die Piraten trotzdem an Bord kommen? Ruhe bewahren, die verlangten Sachen übergeben und wenn möglich eine Eskalation der Situation vermeiden. Diese Situation besprechen wir natürlich auch mit unseren Kindern. Sobald wir Piratenalarm geben würden, sollen sie den Laptop verstecken, den GPS und den Fotoapparat gegen einen defekten austauschen und sich mit Schwimmwesten in ihre Kojen legen. Und da sie couragiert sind und Fantasie haben, legen sie auch gleich ihre Feuerwerksknaller griffbereit und überlegen sich ausgekügelte Fallen, damit die Piraten schon gar nicht auf die Muscat klettern können. Soweit unsere Planung für den Notfall. Das ganze Abenteuer ist schon ohne Piraten aufregend und zur Abwechslung mal mit drei anderen Segelbooten zusammen zu segeln macht Spass.
Zu unserer Überraschung wird der „Switch Switch“ Ruf oft aktiviert und fleissig auf SSB über alles Mögliche gequatscht. Sobald eine Yacht nahe genug vorbei segelt, stehen alle in Pose um tolle Fotos schiessen zu können. Am Morgen des zweiten Tages sehen wir am Horizont den Katamaran von Freunden. Sie haben sich keinem Konvoi angeschlossen, da sie dafür zu langsam seien und auch nichts befürchten. Wir verkleiden uns als Piraten und ziehen unsere Piratenflagge auf. Um acht Uhr morgens haben wir sie steuerbord eingeholt. Die Knaller in der Blechbüchse knallen extrem laut. Im Nu stehen Pat und Allie im Cockpit, während Yanik und Fabien wild mit den Schwertern rumfuchteln und rumknallen. Der Spass ist für alle gross! Nun müssen wir aber schleunigst wieder zu unserem Konvoi zurück. Ein Schnellboot braust auf unseren Konvoi zu. Der Alarm für besondere Aufmerksamkeit wird ausgelöst. Das Schnellboot passiert uns und verschwindet am Horizont. Später kreuzt uns eine Dhau. Wir winken uns gegenseitig fröhlich zu und behalten ihren Kurs im Auge. Über Funk hören wir immer wieder Aufrufe von Kriegsschiffe an Frachtschiffe. Die Frachtschiffe werden aufgefordert alle ihre Schiffsdaten, was sie geladen haben, die Namen des Kapitäns und des ersten Offiziers, deren Nationalität, Anzahl der Matrosen und deren Nationalitäten, Start- und Zielorte anzugeben. Eifrig hören wir diese interessanten Angaben mit. Am Abend erscheint am Horizont ein Kriegsschiff. Unsere Freunde nehmen Kontakt mit ihnen auf. Prompt werden auch sämtliche Daten aller Segelschiffe und deren Bewohner in unserem Konvoi erfragt und beantwortet. Dies wundert uns insofern, als das wir sonst ja ganz vorsichtig mit den Funkgesprächen waren und jetzt mit all den Angaben über unsere Schiffe sicher auch potentielle Piraten bestens informiert wären. Das englische Kriegsschiff A109 mit dem Namen Bayleaf versorgt eigentlich andere Kriegsschiffe mit Diesel und Proviant, hat aber im Moment freie Zeit und wird uns in den nächsten 24 Stunden durch die kritische 300 sm Zone begleiten. Fortan steht Bayleaf am Horizont wie ein grosser dunkler Schatten und hält ab und zu ein Schwätzchen mit unseren Segelschiffen im Konvoi. Für uns ist das alles unglaublich interessant. 24 Stunden später muss sich Bayleaf von uns verabschieden, sie haben ja doch noch anderes zu tun und müssen wieder nach Osten zurück fahren. Good bye – und vielen Dank für den Geleitschutz! Kurz darauf hören wir einen Motorlärm und schon hängen Hände an unserem Relingnetz und behelmte Köpfe lachen uns an. „Wir sind der Kapitän, der erste Offizier und die Navigatorin des Kriegsschiffes und bringen für jeden von euch Eiscreme!“ Unglaublich, wir können es kaum fassen! Hunderte von Seemeilen vom Land entfernt bekommt jeder im Konvoi festgefrorene irische Vanilleeiskreme über die Reling serviert!
Auf der Höhe von Aden haben wir die gefährlichste Piraten-Zone passiert. Unsere Freunde laufen den Hafen von Aden an. Alleine segeln wir weiter zur Meerenge Bab el Mandab zwischen Jemen und dem Horn von Afrika (Somalia). Der Wind lässt nach und bald laufen wir wieder einmal unter Maschine. Nach der Meerenge bläst uns schon der berüchtigte Nordwind des Roten Meeres auf die Nase. Muscat stampft weiter auf der jemenitischen Seite entlang. Riesige Frachtschiffe passieren uns. Wie aufmerksam ist wohl deren Crew? Nun, mit unserem Aluminiumboot sollten wir gut auf dem Radar sichtbar sein. Aber wie steht es mit den drei kleinen hölzernen Fischerbooten, die versuchen vor dem Frachtschiff noch durchzukommen? Andi funkt eine Warnung an das Frachtschiff und tatsächlich muss es leicht seinen Kurs anpassen. Glück gehabt, ihr Fischer!? Erholungsstopp auf Hanish Island, Yemen Gegen Wind und Wellen anzugehen ist immer mühsam.
Wir beschliessen frühmorgens einen Stopp in einer Bucht der Hanish Inseln, die zu Yemen gehören, aber ziemlich in der Mitte des Roten Meeres zwischen Eritrea und Yemen liegen. Auf acht Metern lassen wir den Anker fallen. Vor uns erhebt sich ein schwarzer Vulkankegel aus einer kargen hügeligen, in allen Brauntönen gepinselte Landschaft aus Stein- und Sandhügeln. Von Menschen sind keinerlei Anzeichen zu sehen. Westlich von uns können wir verlassene, kleine Steinhöhlen ausmachen, die vielleicht ab und zu Fischern als Unterschlupf dienen könnten. Nach so einer langen und mühsamen Fahrt haben wir uns ein reiches Frühstück mit Rösti, Spiegelei und weissen Bohnen verdient. Während Andi und ich müde von den Nachtwachen sind, wollen unsere ausgeschlafenen Kinder natürlich sofort an den Strand mit den hohen Sanddünen. Sie setzen sich zu dritt auf unser Surfbrett und paddeln alleine die wenigen Meter im seichten Wasser hinüber. Ich versichere mich, dass sie gut an Land angekommen sind und erledige den Abwasch in der Pantry. Wenige Minuten später komme ich zurück ins Cockpit um zu schauen dass alles in Ordnung ist am Strand. Ich komme gerade rechtzeitig um zu sehen, dass eine Gruppe von etwa acht Soldaten mit geschulterten Maschinengewehren von Westen her auf unsere ahnungslose am Strand spielende Kinder zu rennen! Oh je, was bahnt sich da an? Werden sie den Kindern illegale Einreise in den Yemen vorwerfen? Andi schläft, das Dingi ist noch an Deck festgezurrt, der Motor hinten am Heck hängend. Ich könnte mich noch mit langen Hosen und T-Shirt bekleiden und an Land schwimmen. Vorerst hole ich den Feldstecher und beobachte die Situation vom Schiff aus, was von den Soldaten auch registriert wird. Da stehen nun also diese acht Soldaten in Kriegsmontur und sprechen unsere Kinder an. Was geht da vor? Dann schütteln sich alle die Hände, gucken und zeigen zu uns. Ich winke. Mir scheinen die Soldaten ein wenig ratlos. Was sollen sie jetzt tun mit diesen drei Kindern in Badehosen? Blondschopf Floris hält fest seinen kleinen Bagger in der Hand und Yanik zieht das Surfbrett weiter hinauf. Dann winken Yanik und Fabien den Soldaten zu, nehmen Floris an die Hand und rennen die Sanddüne rauf. Die Soldaten diskutieren, zwei machen Anstalten ihnen zu folgen, weitere pfeifen ihnen laut nach. Die Kinder lassen sich nicht stören und rennen weiter. Wenig später düst ein Lastwagen mit offener Ladefläche heran, auf denen ein strammer Soldat höheren Ranges und weitere Soldaten stramm stehen. Alle steigen aus, reden und zeigen die Düne hinauf zu den Kindern. Die Soldaten zeigen dem Chef das Surfbrett, das sie umkehren und untersuchen. Ein paar setzen sich darauf, alle warten, schauen den Kindern zu und reden. Ich sehe unsere Kinder im Sand herum toben. Nach der langen Fahrt tut ihnen das nur gut. Später kommen sie zum Surfbrett zurück, gehen an den Soldaten vorbei, rufen Good-bye und paddeln davon. Die Soldaten stehen am Strand und gucken ihnen weiter ratlos nach. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was die Soldaten gesagt haben. „Nun sie wollten wissen woher wir kommen, wohin wir gehen, wie unser Schiff heisst, welche Flagge wir haben, wie viele Personen an Bord sind, wie wir heissen und solches Zeugs.“ „Und sonst?“ frage ich nach. „Nichts, ich habe ihnen gesagt dass sie auf unser Surfbrett aufpassen sollen und dann sind wir spielen gegangen“ meint Fabien gelassen.
Quer über das Rote Meer
Sicher ist, dass wir Erwachsene hier keinen Landgang machen. Am späten Abend heben wir den Anker und legen los für die letzten 80 Meilen zur kleinen Hafenstadt Massawa in Eritrea. In einer mondlosen Nacht durchqueren wir die Schifffahrtsstrasse Richtung Afrika. Durch das Fernglas und mit Hilfe des Radars beobachte ich den Kursverlauf der schnellen Meergiganten. Manchmal wird mir ein bisschen mulmig, wenn sie so schnell auf uns Kurs halten. Doch ich bin sicher, wir sind auf dem Radar sicht- und notfalls hörbar. Afrika ist in Sicht! Ein weiterer Meilenstein ist geschafft. Diesen Kontinenten haben wir im Jahr 2000 schon einmal angefahren, damals an der Ostküste auf dem Weg nach Amerika! Zwei Wale kreuzen unseren Weg. Vorbei an kleinen Inseln und Riffen fahren wir in den Hafen von Massawa ein. Hier sieht es aus, als ob gerade ein Krieg stattgefunden hätte! Zerbombte Häuser und rostige Wracks säumen die Einfahrt. Wie ein Monument steht der zerbombte Palast von Haile Gebralassie im Hafen, den er bewohnt hatte, bevor sich Eritrea im dreissigjährigen Krieg von dem riesigen Nachbarn Äthiopien, der gerne einen Meerhafen gehabt hätte, befreien konnte. Wir ankern im Ankerfeld in einem Seitenarm des Hafens. Das Einklarieren verläuft ohne Probleme. Die ersten 48 Stunden können wir hier kostenlos bleiben, allerdings dürfen wir Massawa nicht verlassen. Für eine Verlängerung müssten wir 50 US$ (die Kinder die Hälfte) hinblättern. Uns lockt eine Fahrt auf die 2000 m über Meer gelegene Hauptstadt Asmara und überhaupt die Entdeckung dieses freundlichen, christlichen Landes mit italienischem Flair sehr. Unser Ziel im Frühling in der Türkei zu sein, lässt aber keine längeren Aufenthalte, die diese hohen Gebühren rechtfertigen würden, zu. So erleben wir in Ruhe und ohne Hetze schöne Tage in Massawa und lernen liebe, gastfreundliche Menschen kennen. Vor uns liegen 1500 Seemeilen nordwärts Richtung Suezkanal, durch das berüchtigte Rote Meer – berüchtigt weil fast immer ein strammer Nordwind bläst. Wir werden uns in Geduld üben müssen, um unangenehme Fahrten in dem mit Riffen gespickten Meer zu vermeiden.