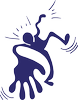Kia Ora in Tahiti (Herzlich Willkommen in Tahiti)
Papeete ist das kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum von Französisch Polynesien. Mehr als 100000 Einwohner wohnen eng zusammen meist dem Meer entlang auf Tahiti, vor allem in Papeete und seinen Vororten Faa’a, Pirae und Arue. Auf dieser kleinen Insel kann ein Arbeitsweg ohne weiteres 1 Stunde dauern, den man auf der Schnellstrasse in sehr hohen Tempo hinter sich bringt. Die Bewohner von Tahiti werden in die drei Hauptgruppen Polynesier, Chinesen und Europäer eingeteilt.
die meist unter sich bleiben. Nach Aussage von einer europäischen (französischen) Einwohnerin ist dies besonders im Arbeitsbereich spürbar, so stellen die drei Gruppen meist nur Leute aus den eigenen Reihen ein. Die Politik liegt in den Händen der Minderheit „Franzosen“, der Handelsbereich in chinesischen Händen, so bleibt Landwirtschaft und Fischerei übrig für die Polynesier.
Wohin zieht es uns Segler als erstes in Tahiti? Natürlich in das Supermarkt – Schlaraffenland, gleich um die Ecke bei der Maeva Beach, wo unsere Muscat hinter dem Riff sicher vor Anker liegt. Unterwegs treffen wir einige uns bekannte Segler, so spinnen wir unser neuestes Seemannsgarn auf dem Einkaufsweg und benötigen fast eine Stunde für die ca. 700 m.
„Sogar richtige, frische Erdbeeren, bieten sie im Supermarkt an, begeistert sich Gabi vom englischen Schiff „Steadfast“. „Das Körbchen à 250 g kostet allerdings ca. 25 Schweizer Franken,“ fügt sie an. Unsere Begeisterung wandelt sich in Unglauben. „Keine Sorge, sie sind auch offen im Angebot und wir haben bei diesen Preisen frech einige degustiert!!“ Tatsächlich bietet der Supermarkt alles an, was sich des Schlemmers Herz begehrt, aber zu Preisen, wo uns der Appetit gleich wieder vergeht. Die Erdbeeren lassen wir uns dennoch nicht entgehen. Man sieht schon, dass wir nicht die ersten am Stand waren. Wir drücken uns etwa dreimal richtig auffällig an den Erdbeeren vorbei, bis wir uns getrauen eine zu „degustieren“. Ich verschlucke die Beere gleich mit Stiel. Falls mir jetzt einer auf die Schultern klopft, ist hoffentlich nichts mehr zu finden. Trotz des Stresses mundet diese hellrote Beere wunderbar. Verhältnismässig zu den Marquesas ist es hier ja sonst günstig und das Angebot unglaublich reichhaltig, doch stockt uns bei manchem Fantasiepreis sogar als Schweizer der Atem.
Die Stadt Papeete erinnert uns ein bisschen an Nizza. Die Hauptverkehrsachsen führen gleich dem Meer entlang, dahinter pulsiert eine Stadt mit französischem Flair. Viele kleine (Chinesen-)Shops verkaufen vor allem Souvenirs, Mode, Krims Krams und natürlich schwarze Perlen. In der Markhalle verkaufen Polynesier frisches Gemüse, Früchte, Fische und Souvenirs, romantische polynesische Musik durchzieht die belebte, farbenprächtige Hallen.
Auf den Strassen fliesst der Verkehr schnell und rücksichtslos. Mit unseren den Verkehr nicht gewohnten Kindern ist das Flanieren eine Tortur, eine Fussgängerzone ist hier unbekannt, eine Strasse zu überqueren wird auch ohne Kinder zu einem lebensgefährlichen Kunststück. Wir verziehen uns auf den grossen (Volks-)Platz beim Hafen, wo die reichlich vorhandenen Sicherheitsleute endlich etwas zu tun haben und uns darauf aufmerksam machen, nicht an eine Säule zu lehnen, die Kinder nicht auf den kleinen Felsbrocken klettern zu lassen und bitte nicht über den Mauervorsprung lehnen. Ich suche mit den Kindern die grosse, sehr saubere, öffentliche Toilette auf. Als ich Fabiens Hose wieder hochziehe, verdunkelt ein grosser Schatten die Damentoilette. Da steht einer dieser rot-weiss bekleideten, männlichen Sicherheitsleute im Türrahmen und kontrolliert sogar noch in der Damentoilette, ob wir uns artig benehmen. Wo bin ich hier? Wer bin ich hier? Ein Kontrollblick in den Spiegel zeigt mir eine braungebrannte Frau in einem langen Rock. Ganz anständig finde ich jedenfalls.
Ich fahre mit den zwei stadtmüden, quengelnden Buben in einem originellen Truck-Bus mit Holzaufbau wieder zurück zur Maeva Beach, während Andi noch einige Ersatzteile für die „Muscat“ einkauft. Diese kleinen Lastwagen mit selbstgebauten, gedeckten Aufbau in dem zwei lange Bänke den Kunden Sitzplatz bieten, fahren ihre Route zu günstigen Preisen. Zurück am Dingisteg fällt mir auf, dass das Dingi umparkiert ist. Zuerst nehme ich an, dass es jemandem im Weg war. Kaum bin ich ausser Rufweite vom Land weggefahren, setzt der erst frisch aufgetankte Motor wegen Benzinmangel aus. Spätestens jetzt ist mir klar, dass jemand nicht nur den Tank geleert hat, sondern gleich den vollen Benzinkanister mitlaufen liess. Ziemlich frustriert werde ich aber schon nach wenigen Minuten von einem hilfsbereiten „Yachtie zur „Muscat“ abgeschleppt.
Die Stadt habe ich schnell gesehen und begnüge mich die nächsten vierzehn Tage mehrheitlich mit einem Besuch auf dem wohl einzigen Spielplatz von Papeete im McDonalds direkt bei der Maeva Beach und dem angrenzendem öffentlichen Mini-Strand. Da sitze ich nun mit Lydia und Marius von „Largostar“ fast jeden Nachmittag. Die Kinder haben zusammen viel Spass und schlecken ab und zu ein Eis. Andi installiert inzwischen fleissig Computer Netzwerke. Er hat hier einen jungen Finnen kennen gelernt, der sehr viel zu tun hat und Unterstützung benötigt. Nebst der Abwechslung ist uns der damit verbundene, gratis Internetzugang wichtig. Nach langer Zeit können wir wieder in alle Ruhe E-Mails beantworten und die Homepage aktualisieren.
Hin- und her haben wir uns die Konsequenzen einer nicht korrekten Anmeldung bei der Immigration und beim Zoll in Papeete überlegt. Unsere Garantiesumme (siehe letzten Reisebericht Marquesas – Tahiti) haben wir immer noch nicht bezahlt. Falls wir kontrolliert werden, würde es sicher Probleme mit den Behörden geben, vielleicht könnten wir die Summe nachträglich hinterlegen, ansonsten müssten wir uns als „persona non grata“ ausweisen lassen. Natürlich macht mich diese Situation etwas nervös. Bei einem Spaziergang in der Stadt, treffe ich im Garten von der Immigration den befreundeten Schweizer Segler Edi von „Helene II“. Wir begrüssen uns herzlich und halten einen Schwatz. Kurz vor Mittag spricht uns der Immigration Beamte freundlich an und erkundigt sich, ob wir schon einklariert haben. Wie gut ist wohl sein Erinnerungsvermögen an schon oder eben noch nicht gesehene Gesichter? Mir verschlägt es gleich mal die Sprache, lächle den Beamten starr an und bin froh um Edis tolles französisch. „Seine Frau Elsi wäre schon im Büro, alles ist in Ordnung, vielen Dank für die Nachfrage,“ schwatzt Edi.
„Ja wissen sie, wir haben bald Mittagszeit“, meint der Beamte.
Ich ziehe einen Ortswechsel für weitere Schwätzchen vor und verlasse das „feindliche“ Territorium.
Die Zeit vergeht im Fluge, schnell wurden aus der vorgesehenen Woche Aufenthalt fast drei Wochen. Unsere Hauptmaschine läuft wieder wie am Schnürchen, der Grund ist uns noch nicht ganz klar, irgendwo könnte es ab und zu einen Wackelkontakt geben. Alle Kabel sind kontrolliert und geputzt, die Filter gewechselt und die Dieselleitungen gereinigt. Zeit um uns auf die Weiterfahrt zur Insel Huahine einzustellen.
May Day der Schweizer Yacht „Amoha“
Am nächsten Morgen hören wir auf der morgendlichen Funkrunde, dass unsere Schweizer Seglergefährten Paolo und Marlies auf der kleinen Schweizeryacht „Amoha“ einen Notruf über Inmarsat abgegeben haben. Paolo habe ich auf meinem ersten Ausbildungstörn anfangs der neunziger Jahre kennen gelernt. Wir haben ihn und seine Frau Marlies unterwegs an verschiedenen Orten immer wieder getroffen. Jetzt treiben sie ohne Ruder, das ist ihnen unbemerkt abgebrochen, steuerlos in hohen Wellenbergen mit über vierzig Knoten Wind zwischen den Gesellschaftsinseln und dem Atoll Suvarov, das zu den nördlichen Cook Inseln gehört. – Die „Amoha“ ist etwa 150 Seemeilen von Suvarov entfernt. Abschleppen ist auf diese Distanz und bei diesem Seegang nicht möglich. Der absetzte, höchste Notruf „May-Day“ wurde unter anderem von Yachten in Suvarov aufgefangen. Ein privates, amerikanisches Motorboot macht sich zur Rettung auf und dreht bei „Amoha“ bei. Was tun? Sollen sie ihr Schiff aufgeben und die „Amoha“ herrenlos treiben lassen mit ihrer gesamten Habe und Ausrüstung? Oder gleich versenken? Oder weiter auf dem 10 m langen, steuerlosen Schiff in rauer See verharren? Auf der Funkrunde ist jedermann aufgeregt, die Tips und Ratschläge werden grosszügig verteilt, Mut zugesprochen, doch jeder der Ratgebenden ist sich bewusst, dass er selber nicht in dieser unkomfortablen, stressigen Situation ist.
Am nächsten Morgen, ein Sonntag, erklärt Paolo, dass sie sich definitiv entschlossen haben, dass Schiff zu verlassen. In dieser rauen See sich weiter 24 Stunden am Tag für unbestimmte Zeit herumrütteln lassen, steuerlos und weit ab von irgendwelchem Land, wer würde da anders entscheiden? Wir sind alle sehr traurig und bestürzt, denn dies ist ein sehr schwerer Entschluss.
Am Montag morgen vernehmen wir, dass Paolo und Marlies, Amoha nicht aufgegeben haben. Vorerst haben sie genügend Essen, Trinken und wollen die „Amoha“ noch nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Sie treiben langsam nach WNW und während dem Tag können sie mit dem selbstgebauten Notruder mehr oder weniger die Richtung nach Suvarov halten. Während der Nacht nehmen sie die Segel runter und lassen sich treiben. So driften sie mit ca. 30 sm pro Tag zum Atoll. Das Motorboot kehrt in das Atoll Suvarov zurück, bereit jederzeit wieder zur „Amoha“ herauszufahren und zu helfen. Wir stellen eine 24 Stunden Funkwache auf die Beine, damit der Kontakt mit Paolo und Marlies gesichert ist und sie für ein Gespräch und Ratschläge immer jemanden erreichen könnten.
Inzwischen sendet der italienische Konstrukteur der „Amoha“ die technischen Pläne des Schiffes an uns. Andi lässt eine neue Chromstahl-Achse anfertigen und kauft Holz, Schaum, Glasfaser und Polyester, damit Paolo und die anderen Segler in Suvarov ein neues Ruder bauen können. Nun werden auf allen englischen, französischen und deutschen Funknetzen zum Auslaufen bereite Yachten mit Ziel Suvarov gesucht. Schliesslich meldet sich Bernhard von der „Kelston“ aus der Bucht in Huahine, die zu den Gesellschaftsinseln gehört. Mit Einzelteilen und Material für einen Ruderbau auf dem einsamen Atoll „Suvarov“ beladen, verlassen wir Tahiti schliesslich nach fast 4 Wochen Aufenthalt und segeln nordwärts nach Huahine. Zusammen mit Bernhard kaufen wir dort nochmals kräftig Gemüse und Früchte für die Segler in Suvarov ein und übergeben ihm das Material für das neue Ruder. Am nächsten Morgen segelt Bernhard weiter.
Die „Amoha“ liegt „wunderbar“ auf Kurs, allerdings im Schneckentempo. Nach fünf Tagen manöverunfähigem Treiben auf hoher See, kann sie schliesslich kurz vor Suvarov an die Leine genommen und in die Lagune abgeschleppt werden. Bernhard bricht auf seiner Überfahrt von Huahine nach Suvarov schliesslich noch den Grossbaum, sozusagen „live“ auf der Funkrunde. Als er am nächsten Morgen nach einer Nacht auf hoher See ohne Grossbaum vom Funkrunde-Manager Winfried gefragt wurde, wie denn die Nacht so gelaufen wäre, meinte er in herzhaftem bayrisch: „Ja, dass weiss ich doch nicht, ich habe die gut geschlafen!“
Unter den Yachties auf Suvarov befindet sich ein Bootsbauer. Sie bauen unter Kokospalmen am Sandstrand ein neues Ruder und flicken mit dem Material gleich noch den Grossbaum der „Kelston“. Wir sind alle sehr erleichtert, dass dieser Ruderbruch so gimpflich abgelaufen ist. Übrigens wurde uns versichert, dass trotz der vielen Arbeiten, die Strandparties und Grillabende mit frischem, selbstgefangenem Fisch nicht zu kurz gekommen wären und wunderschöne Abendstunden mit Gitarrenklängen mit den zwei auf Suvarov lebenden Parkranger verbracht wurden. Wer sich übrigens für das Leben auf dem Atoll Suvarov interessiert, dem sei das Buch von Tom Neale empfohlen.
Huahine, Gesellschaftsinseln
Zurück zu den Gesellschaftsinseln, wo wir Huahine geniessen, das uns viel besser gefällt als Tahiti. Etwa 5’500 Einwohner besiedeln Huahine. Eine vielseitige, ursprüngliche, herrlich grüne, bewaldete Insel erwartet uns. Delfine spielen idyllisch in der Passage, die Lagune scheint sauber, das Riff ist belebt, obwohl wir uns sagen lassen, dass das Meer um die Gesellschaftsinseln ziemlich leer gefischt sein soll. Natürlich hält auch auf Huahine der Tourismus Einzug, doch die Hotels sind gut an die Insel angespasst. Fare heisst der kleine Hauptort. Die Familien (Sippen) wohnen mehr oder weniger traditionell in ihren eigenen, kleinen Häusern am Strand oder im grünen Landesinnern. Zu jeder Familie gehört, wie in ganz Polynesien üblich, eine Schar von Hunden sowie ein grosser Geländewagen. Auf dem sippen-eigenen Land wachsen Bananen, Papaya, Vanille und natürlich werden Schweine für den Erdofen gehalten. Bei diesen hohen Preisen ist es wichtig, möglichst weitgehend selbstversorgend zu sein. Polynesische Spitzbuben spielen am Steg, lachen die Yachties freundlich an. Ab und zu findet einer der „reichen“ Yachties sein Dingi losgebunden, treibend gegen das grosse Meer hinaus, was der Betroffene natürlich weniger lustig findet.
Im Supermarkt spricht uns Louise an. Sie kam vor zehn Jahren mit ihrem Kleinkind von Kanada nach Huahine und heiratete den „Stammeshäuptling“. Sie wurde Ziehmutter von den Kindern ihres Mannes, sowie einigen von der weiteren Familie, dass nimmt man in Polynesien nicht so genau. Wir besuchen sie in ihrem kleinen Haus an wunderschöner Lage auf familieneigenem Grundstück mit kleiner Bananen- und Vanille-Plantage. Ein idyllischer Campingplatz, ausgerüstet mit allen Sanitärinstallationen gehört dazu, doch kann ihn Louise nicht betreiben, da alle Sippen-Mitglieder, auch im weitesten Sinne, mit einer solchen Beschäftigung gefragt und einverstanden sein müssen. In diesem Falle wollen einige Sippenmitglieder keine Pakeas (Fremdlinge) auf ihrem Grund und Boden, so kann der schöne Camping nicht betrieben werden. Es ist traditionell, dass der einzelnen Person praktisch nichts, sondern alles der ganzen Familie gehört. Wir hören viel über die Problematik des Zusammenlebens der Polynesier mit den Franzosen und darüber wie schwierig es ist, eine mehrköpfige Familie in den teuren Gesellschaftsinseln zu ernähren. Sie ist dankbar, dass ihr stolzer, hünenhafter, polynesischer Mann seine Tradition lebt, und nicht wie viele andere polynesische Männer dem Alkohol verfallen ist.
Am geschenkten, riesigen Bananenstrunk zählen wir über hundert Bananen, zu viel für uns alleine. Bananen haben den Nachteil, dass über Nacht alle miteinander reif werden und in den nächsten Tagen gegessen sein wollen. Wir verschenken viele an Yachties, die sich sehr darüber freuen. Huahine ist eine sehr fruchtbare Insel, Chilli, Brotfrüchte, Orangen, Papaya und Kokosnüsse wachsen hier in Hülle und Fülle, wir müssen sie nur pflücken auf unseren Spaziergängen im Wald.
Wir erklimmen hohe Klippen mit Sicht zu den Nachbarninseln. Auf den Klippen starren furchterregende Steinskulpturen aus der frühen Maorizeit auf das Meer. Wir lassen uns belehren, dass diese „Tiki“ allesamt „Made in den Philippinen“ seien. Erst vor vier Jahren hat man hier eine kleine Hotelanlage hingestellt, davon zeugen ein verlottertes Haus und ein grün bemooster Swimmingpool an romantischer Lage im Wald. Leider fiel das ganze Projekt schon bald einer Windhose in der Hurrikansaison zum Opfer.
Wir geniessen unsere Landspaziergänge im Grünen, bauen kleine Staudämme in den Bach, der aus dem Wald plätschernd ins Meer fliesst. Wir schnorcheln, fahren auf der wenig befahrenen Strasse Fahrrad, feiern Geburtstage und nehmen an Yachtie-Grillabenden teil. Auf Huahine fühlen wir uns wohl.
Tahaa, Gesellschaftsinseln
Unser nächster Stop liegt in Sichtweite auf der Nachbarinsel Tahaa. Eine angenehme Tagessreise entfernt, lassen wir den Anker vor einem kleinen Motu (vorgelagerte Sandinsel innerhalb des Riffes) in der Lagune fallen. Am nächsten Morgen landen wir im Dingi auf der kleinen Sandinsel unter den Kokospalmen. Ein paar Einheimische putzen mit Reisigbesen den Sandstrand. Mit Schnorchelzeug und den Surfbrettern für die Kindern wollen wir im flachen Wasser die Korallenstöcke erforschen. Es ist ideal für uns, das Wasser ist sehr ruhig und nur hüfthoch. Es wachsen wunderschöne Korallenstöcke, die farbigen Rifffische schwimmen in greifbarer Nähe, sogar zwei Oktopusse können wir Yanik vor seiner Nase zeigen. Einen würde ich gerne später in meiner Bratpfanne sehen. Ich fordere Andi auf, mal zu zeigen, wie einfach man eben so einen achtarmigen, weichen Tintenfisch fange. Doch wir bringen es nicht übers Herz. Es ist einfach zu schön hier, um in diese Idylle einzugreifen. Wir bevorzugen, den zwei (verliebten?) Oktopusse, Koffer-, Trompeten-, Papgeien-, Doktorfische und wie sie alle heissen, zu zuschauen.
Zurück am Strand erwartet uns eine Überraschung anderer Art: Ein Sonnentourist neben dem andern sonnt sich am Sandstrand. Wo kommen die plötzlich her? Die Strandreiniger haben sich zu Barkeeper gemausert, die Party kann beginnen! Schön, dass wir schon so früh da waren, die Sonne steht wieder hoch am Himmel und für uns ist es Zeit auf „Muscat“ zurück zu kehren. Wir essen einen kleinen Lunch, heben den Anker und fahren innerhalb des Riffs der grünen, bewaldeten Hauptinsel entlang unter Motor weiter zum Pass auf der anderen Seite. Es ist hier nämlich möglich, die Insel innerhalb des Riffes zu umrunden. Tahaa hat zwei Passagen, so fahren wir im Osten in die Lagune hinein und tuckern wie auf einem Fluss in aller Ruhe und mit reichlichen Zwischenstopps auf den Motus zur Westpassage.
Die Gesellschaftsinseln sind so nahe beisammen, dass wir auf Tahaa über UKW nach Bora Bora funken können. Unsere Freunde auf dem Katamaran „Skive“ freuen sich, von uns zu hören und wollen, dass wir schon am nächsten Tag zum grossen Grillfest und Hannah’s Geburtstagsparty in Bora Bora eintreffen. Natürlich, dass muss man uns nicht zwei mal sagen. Zwar wären wir gerne länger auf dieser schönen Insel geblieben, hätten gerne mehr von der bewaldeten Landschaft gesehen, doch die Aussicht auf das Wiedertreffen mit vielen bekannten Yachties und die Kindergeburtstagsparty verleiten uns zur schnellen Abreise. Wir suchen uns einen sicheren Ankerplatz in einer sehr tiefen Bucht der Hauptinsel. 25 m und mehr ist das Wasser hier tief, zu tief um sicher zu ankern. Wir wundern uns, dass es in unserer Karte als geeigneter Ankerplatz eingezeichnet ist. Mitten in der Bucht fahren wir plötzlich auf Sand auf. Mit einigem Manövern sind wir bald wieder frei, inzwischen ist es dämmrig, zudem fahren wir im Schatten von den Hängen und Bäumen. Das Wasser ist braun und trüb, kein Boden ist auszumachen. Langsam tasten wir uns vor und stellen fest, dass der Grund tatsächlich fast immer um 25 m tief ist und dann plötzlich steil auf Knietiefe ansteigt! Dazwischen finden wir nichts. Wir beschliessen, die Muscat an eine der drei Bojen einer Charterfirma festzubinden. Es ist schon spät und wir wollen ja früh los.
Noch bevor die Sonne am Horizont aufgeht, fahren wir in der Morgenröte aus der Passage auf das offene, ruhige Meer hinaus zum Traumparadies Bora Bora. Ein alter Schlager mit gleichem Namen klingt in meinen Ohren und ich spüre eine grosse Freude. Wieviel vom Taumparadies erwartet uns wohl in Bora Bora?
Trauminsel Bora Bora, Gesellschaftsinseln
Traumhaft ist jedenfalls die Überfahrt. Bei Sonnenaufgang passieren wir den Pass von Tahaa’a. Am Horizont liegt die Trauminsel im Morgenrot. Schon am Mittag haben wir das Ziel erreicht, der berühmte markante Kegel des alten Vulkanes liegt vor uns. Am frühen Nachmittag passieren wir die Einfahrt in die Lagune von Bora Bora. Sie ist sehr weit, ruhig und einfach. Schwieriger ist da schon die Fahrt durch die Lagune. Im Zentrum ragt der 700 m hohe, weltberühmte Vulkankegel sattgrün aus der Lagune. Wir fahren an den teuersten Hotelanlagen auf Stelzen mit Palmendächern vorbei. Der Traum vieler Hochzeitsreisender kostet nur die Kleinigkeit von mehr oder weniger US$ 500 pro Nacht. Dafür bewohnen die Glücklichen ihre eigenen vier Wände auf Stelzen über dem glasklaren Wasser. Manche sind mit einem Glasboden ausgerüstet, so können die Verliebten zwischendurch bequem vom Bett aus die wunderschöne Unterwasserwelt beobachten. Der „Sundowner“ wird auf dem Barhocker mitten im Pool genossen.
Die Fahrrinne ist gut signalisiert, trotzdem müssen wir ganz genau nach der Seekarte fahren, damit wir nicht auf Korallenstöcken oder Sandbänken landen. Teilweise beträgt die Tiefe nur 1.70 m, das stellen wir mit unserem Echolot fest. Der hellblaue Farbton des Meeres mahnt uns zu grösster Vorsicht. Vor uns tuckert ein Katamaran, die Versuchung hinterher zu fahren ist gross, doch wäre dies bei seinem kleinen Tiefgang für uns fatal. So fahren wir brav in grossen Kurven fast um die ganze Hauptinsel zu unserem Ankerplatz, wo die Tiefe auf wenige Zentimeter abfällt und für alle Schiffe Endstation ist.
Wir sind nicht die ersten Segler am südlichen, glasklaren, türkisblauen Ankerplatz. Vor uns ankern schon um die fünfzig Yachten. Es hat zum Glück genügend Platz für alle und mit unserem nur 1.5 m Tiefgang ankern wir in der vordersten Reihe. Unsere ganze Familie springt im Nu ins klare, lauwarme Wasser. Ein traumhafter Badeplausch bietet unser Ankerplatz hier. Später gehen wir mit Hannah und allen Seglerkinder auf die grosse Schatzsuche und geniessen am Abend ein feines BBQ (Grillfest) mit vielen altbekannten und neuen Gesichtern.
Haie, Mantas und Stachelrochen
Nach vier paradiesisch, sonnigen Badetagen ändert sich das Wetter schlagartig, es ist grau, neblig und regnerisch. Das Wasser hat sich abgekühlt durch die unruhige See und die verminderte Sonneneinstrahlung. Der wunderschöne, grüne, hohe Vulkankegel von Bora Bora verschwindet in Regenwolken.
Trotz des unfreundlichen Wetters gehen wir auf Entdeckungsreise. Mit T-Shirt, Bademäntel und Schnorchelausrüstung bewaffnet, wollen wir mit Yanik und Fabien und der 6jährigen Hannah von „Skive“ die Mantarochen in Bora Bora aufstöbern. Neben der uns schon bekannten Fahrrinne steigt das Riff steil auf. Hier werden jeden Morgen Mantas gesichtet, die schon an Bojen liegenden Touristenzubringer verheissen uns gute Erfolgsaussichten. Voraus schnorchelt Papa Andi, dann die drei Kinder und hinten als Nachhut die Mama, es ist fast wie bei den Enten, nicht wahr? Wir entdecken schöne Korallen und Fische, aber leider keinen der besagten Riesenmantas. Es ist kühl, nach knapp einer Stunde im Wasser, geben wir die Suche auf und hieven die Kinder zurück ins Dingi. Ich verpflege sie mit Keksen und packe alle warm ein. Kaum sind alle zufrieden, ruft Andi uns wieder alle ins Wasser, die Mantas wären da! Nee, die Kinder wollen nicht aus ihrer wohligen Wärme ins „kalte“ Wasser. Tatsächlich schweben Mantas aus der Tiefe hinauf nur wenig unter uns gemächlich durchs Wasser. Die Mantas sind Rochen mit einer Spannweite um 3 m! Sie ernähren sich von Plankton und sind für uns absolut ungefährlich.
Gefährlicher dagegen sind die Stachelrochen. Der Stachelrochen hat einen giftigen Stachel auf seinem Schwanz. Bei Gefahr peitscht der Stachelrochen mit seinem Schwanz gegen das Opfer. Wenn da mal Unfälle passieren dann nur wenn z.B. ein unvorsichtiger Strandgänger aus Versehen auf den Schwanz des Rochens steht, der sich im Sand eingegraben hat und sich ausruht.
In Bora Bora werden am Hauptriff weiter südlich jeden Tag um 10.00 Uhr Stachelrochen und Riffhaie mit Fisch gefüttert. Die Tiere sind sich daran gewöhnt und schwimmen zahlreich heran. Diese Fütterung ist so eindrücklich, dass wir sie zweimal besuchen. Nur durch ein einfaches, horizontal schwebendes Seil sind wir von diesen „gefürchteten“ Tieren getrennt. Die Animatoren stehen zwischen den Tieren und locken sie mit blutigen Fischen an. Elegant und ruhig schwimmen die Haie und Stachelrochen ihre Runden, nur wenige Zentimeter von uns neugierigen, am Seil festhaltenden, mit Brille und Schnorchel neugierig unter Wasser starrenden Witzfiguren (so denkt sich der Hai??) entfernt. Die Fischhappen verschwinden im Nu im Rachen der schnellsten Rochen, Haie oder kleineren fischfressenden Rifffischen. Ich sehe ein Stück Fisch zwischen den Beinen der Gäste davon schweben, ein Hai fährt dazwischen, nimmt sich dieses Stück und kehrt wieder zurück in die Mitte. Nun, meine Beine waren genügend weit weg.
Das Wetter wird endlich wieder besser. Langsam wollen wir unsere nächste grosse Etappe weiter nach Osten zu den südlichen Cook Inseln ins Auge fassen. Das angenehme Feriensegeln wird bald der Vergangenheit angehören. In Zukunft werden wir das Wetter noch sorgfältiger beurteilen. Konnten wir uns bisher auf meist beständigen Passatwind verlassen, wird er auf unserer weiteren Strecke unbeständigeren Windstärken und -richtungen Platz machen.
Eine unangenehme, heikle Sache steht uns jetzt endgültig bevor: Wir müssen uns im Immigrations Büro von Französisch Polynesien, d.h. bei der Polizei im Hauptort verabschieden. Unsere Garantiesumme haben wir ja immer noch nicht bezahlt. Wacker geht Andi mit unseren Papieren zum Polizeiposten. Der Beamte ist sehr freundlich, fertigt alles ordentlich ab und fragt, ob wir die Garantiesumme bezahlt haben.
Andi schildert kurz unsere Zahlungsprobleme in den Marquesas und erwähnt, dass wir in den Tuamotus versucht haben, eine Bank zu finden (Er erwähnt unseren Besuch in Papeete natürlich nicht…). Der Beamte schmunzelt, der Gedanke eine Bank in den Tuamotus zu finden, scheint ihn ausgesprochen zu amüsieren. Ruck zuck, haben wir alle nötigen Papiere zur Hand und können getrost weiter reisen. Im Polizeiposten trifft Andi auf Amerikaner und Kanadier, die heute schon zum zweiten und dritten Mal im Polizeiposten vorbeischauen. Für die Rückforderung der Garantiesumme bei der lokalen Bank benötigen sie Papiere, die sie eigentlich beim Ausklarieren in Papetee hätten bekommen sollen…..
Wir verlassen unseren traumhaften Ankerplatz und tuckern wieder die Lagune zurück Richtung Passage. Gut geschützt hinter einem der vielen Motus gleich neben der Passage warten wir die idealen Wetterbedingungen ab, soweit diese vorauszusagen sind. Am nächsten Morgen ist der Wind perfekt, wir setzen in der Lagune die Segel und segeln romantisch durch die Passage aus dem „Paradies“ hinaus.
Aitutaki, südliche Cookinseln
„Wenn ihr die Gesellschaftsinseln verlässt, hört das bequeme Seglerleben auf. Ihr könnt euch nicht mehr auf den konstanten Passatwind verlassen, der Wind wird seine Richtung oft wechseln und die Wellen werden unregelmässiger und unangenehmer“, so warnte uns Bernhard von der SY Kelston“ noch in Huahine. Vorläufig haben wir es gut getroffen, der Wind weht konstant von Südost mit 10 bis 15 Knoten. Die „Muscat“ rauscht ruhig und konstant Richtung Aitutaki, ein Atoll in den südlichen Cook Inseln. Nachdem wir wochenlang absolut ruhig in den Lagunen gelegen haben, machen Andi und mir die ersten Segeltage noch Mühe. Zwar hätten wir Hunger, doch der Appetit fehlt uns, wir sitzen träge im Cockpit und sind froh um unsere kleinen, hilfreichen Reisetabletten. Die Kinder sind munter und hungrig wie jeden Tag.
Nach zwei Tagen hat sich unsere Bordroutine wieder eingestellt. Am Morgen beginne ich meine Wache nach dem Frühstück, während der ich mit den Kindern spiele, bastle und singe. Kurz vor Mittag koche ich ein feines Mittagessen. Nach dem Essen lege ich mich für ein Nickerchen in meine Koje, während Andi die Wache übernimmt. Frisch gestärkt übernehme ich wieder die Wache am Nachmittag bis in den späten Abend hinein. Andi übernimmt die Wache, nachdem er seinen Schlaf vorgeholt hat für die ganze Nacht. Diese Wacheinteilung ist natürlich nur bei ruhigen Segeltagen möglich.
Unsere zwei 75 W Solarpanele erzeugen genügend Strom für unseren Alltag. Viel Strom verbrauchen der Kühlschrank, den wir selbstverständlich auf dem Minimum laufen lassen sowie der Autopilot. Alle zwei bis drei Tage müssen wir die Hauptmaschine mitlaufen lassen, um die Batterien wieder zu füllen.
So ist es einfach kaum zu glauben, dass unser Motor nach wochenlangem, anstandslosem Anspringen und Laufen am dritten Tag unserer Etappe zu den Cook Inseln nun plötzlich wieder keinen Wank macht. Dringend müssen die Batterien geladen werden, damit unser Autopilot genügend Strom erhält! Insofern haben wir Glück, da unser Ziel nur noch etwa 15 Segelstunden weit entfernt ist. Es ist mir aber schleierhaft, wie wir einen guten Ankergrund vor dem Riff in Aitutaki finden und das Ankermanöver ohne Hilfe des Motors durchführen wollen. Trotz intensiven Suchens der Fehlerquelle ist unser Motor nicht zu starten. Dieses ewige Theater mit dem Motor stinkt uns beiden gewaltig. Andi will in Neuseeland den ganzen Motor neu verkabeln. Wir probieren immer wieder den Motor zu starten, doch ohne Erfolg. Es wird zur Routine ab und zu den Motor zu starten versuchen. Am vierten Segeltag startet er endlich wieder. „Was hast du gemacht, wieso startet der Motor?“ frage ich Andi. „Keine Ahnung, er läuft jetzt wieder!“
Klar, dass wir ihn nicht mehr abstellen und ihn die restlichen 7 Stunden unserer Etappe mitlaufen lassen. Vor dem Riff in Aitutaki finden wir einen kleinen Sandfleck auf 12 Meter Tiefe und lassen unseren Anker fallen. Wieder verschwindet Andi für Stunden im Motorraum, findet aber immer noch nichts.
Die Passage in die geschützte Lagune von Aitutaki ist nur für Schiffe mit Tiefgang von weniger als 1.60 m möglich. Mit unserem Twinkieler ist das für uns problemlos, wenn auch ziemlich knapp. Wir verbringen eine rollige Nacht aussen am Riff und lassen uns am nächsten Morgen bei Hochwasser in die Lagune lotsen. Dem Katamaran „Skive“ mit nur 1.30 m Tiefgang geben wir grosszügig den Vortritt. Sabrina und Patrick von der Schweizer Yacht „Rebekka“ haben am Tag vorher schon alles ausgelotet und weisen uns haargenau mit ihrem Dingi durch die sehr schmale, untiefe Passage in die kleine Lagune ein. Mit ihrem Schoner müssen sie draussen bleiben, denn sie haben zu viel Tiefgang. Wir fahren die Muscat fast auf eine Sandbank auf, lassen den Anker auf 1.20 m auf Grund mit genügend Kette raus. So kommt unsere Schiffsmitte über einer Tiefe von nur 1.80 m gut zu liegen. Mit Heckanker stellen wir sicher, dass sich die Muscat bei ein- oder auslaufendem Wasser nicht dreht. Diese Lagune ist so klein, dass gerade mal vier Schiffe eng zusammen liegend und gut verankert Platz haben. Bedenken müssen wir auch, dass wir bei Springflut (Vollmond) in die Lagune einfuhren und in ein paar Tagen der Hochwasserstand weniger sein wird. Schliesslich wollen wir ja keinen Monat bis zur nächsten Springflut in Aitutaki verweilen.
Blaue Lagunen, feinster Sand, herzliche Leute, Tanz und Musik, das ist Aitutaki!
Heute ist Sonntag und die Gelegenheit an einem hiesigen Gottesdienst teilzunehmen. Elegant schwarz und/oder weiss angezogen, Schultern und Knie züchtig bedeckt und einen flotten Hut auf dem Kopf finden sich die einheimische Bevölkerung in einer der zahlreichen Kirchen ein. Zwar verstehen wir kein Wort von der Predigt, dafür beeindruckt uns der laute, eindrückliche Gesang um so mehr.
Aitutaki bietet viele Gastzimmer bei Familien und in kleinen Gästehäusern an. Jeden Tag bewirtet eines der Restaurants die vielen Rucksackreisenden und die paar Yachties. Nach dem Gottesdienst ziehen wir wieder unsere Strandklamotten an und werden vom Restaurantbesitzer an Land persönlich abgeholt. Die meisten Sandstrände in Polynesien bestehen aus scharfen eckigem Korallenschrott. Hier in Aitutaki aber finden wir den feinsten Sandstrand und eine herrliche smaragdgrüne Lagune. Das Restaurant bietet unter den lauschigen Palmblätterhütten lokale Speisen aus dem Erdofen und jede Menge frische Salate und Gemüse am Buffett an. Eine kleine lokale Bank versüsst uns das reichliche Essen mit romantischer, polynesischer Musik. Nach dem teuren, westlich und kommerziell geprägten Leben in den Gesellschaftsinseln geniessen wir diese wieder ganz andere Insel-Welt.
Die idealen Fahrzeuge um das „schönste Atoll“ in Polynesien zu erkunden sind 125er Motorräder und Fahrräder. Besonderen Spass macht uns die Fahrt über Sandstrände und die holprige Fahrt auf den „höchsten Berg“ von 74 m Höhe auf Aitutaki. Wir sind für einmal ohne Kinder unterwegs, Yanik und Fabien werden während dieser Ausfahrt auf der „Skive“ gehütet.
Hier und dort geniessen wir während unseres Aufenthaltes Tanzshows mit Gesang und Feuertanz. Mit dem Dingi fahren wir zu kleinen einsamen Motus hinaus, spazieren von einer Insel durch die flache Lagune zur andern, lassen Drachen im Passatwind fliegen und geniessen herrliche, unbeschwerte Tage. So vergeht die Zeit allzu schnell, wir müssen den noch hohen Wasserstand wenige Tage nach der Springflut nutzen und Aitutaki nach einer Woche verlassen.
Die Wetterprognose ist gut für die nächsten Tage und mit stolzen 25 Knoten Wind fahren wir los 219 sm zum Nachbaratoll Palmerston. Die See ist ruppig. Ein Wal schwimmt 200 m hinter unserem Schiff zum Abschied von Aitutaki durch und prustet Wasser hoch in die Luft.
Palmerston
Zu schnell kommen wir voran und erreichen das Nachbaratoll Palmerston in der zweiten Nacht morgens um 3 Uhr. Andi geht auf Halbwindkurs und segelt hinter der Insel in ruhigerem Wasser einmal hoch und runter. Um 7 Uhr sind wir wieder vor dem Ankerplatz. Wir sind gespannt, was uns in Palmerston erwartet. Das Atoll besteht aus 35 kleinen Sandinseln und ist an der breitesten Stelle 11 km weit. Es ist das südlichste Atoll der nördlichen Cook Inseln. Die Lagune ist zu flach um hinein zu fahren, so meiden viele Yachties Palmerston, aus Angst vor einem aufkommenden Unwetter, das auf unsicherem Ankergrund, womöglich auf Legerwall oder als Alternative auf hoher See abgewettert werden müsste.
Wir funken über UKW-Kanal 16 die Inselbewohner an. Eine freundliche Stimme begrüsst uns und ein paar Jungs werden im Motorboot zu uns hinaus geschickt, um uns an der neu gesetzten Mooring festzubinden. Wir laden die Jungs und das Mädchen mit dem schönen Namen „Darling“ auf eine Limonade ein.
Mit kleinen Geschenken bepackt, lassen wir uns zur bewohnten Hauptinsel mit dem klangvollen Namen „Paradies“ fahren. Es ist Sonntag, gerade zelebriert die Klan-Chefin des blauen Hauses den Gottesdienst in ihrem Wohnzimmer für ihre Sippe. Wir werden von Aka, dem Oberhaupt des Zweiges „James“ Marsters hereingebeten. Es stellen sich alle vor, sie zeigen uns wo und wie sie wohnen, erzählen uns ihre Fotogalerie und Geschichte, wir natürlich unsere Reise. Bald ist Mittagszeit, während ihre ledige Tochter Sare für die ganze, grosse Familie und die Gäste das Essen zubereitet, führen uns die Urenkel Pearl, JJ und Ati auf der Insel herum und zeigen uns die Schule.
1863 besiedelte der Engländer William Marsters dieses Atoll und zog eine Kokosnussplantage auf. Mit sich brachte er 3 polynesische Schwestern, die er alle „heiratete“. Jeder Frau wies er einen Teil der grössten Insel zu. Um Inzucht zu vermeiden, stellte er strenge Regeln auf. Als er 1899 starb hatte er 21 Kinder gezeugt. Heute noch ist die Insel unter den drei Familienzweigen aufgeteilt. Jede Familie hat sein Haupthaus mit kleinen Palmblätterhütten drum herum. Natürlich ziert auch hier eine schmucke Kirche das Dorf. Die kleine Schule für die zur Zeit 9 Kinder auf der Insel steht ein wenig abseits unter lauschigen Palmen. Auf den Lehrer warten alle sehnsüchtig, der weilt noch in Neuseeland und wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen eintreffen. Durch eine norwegische, grossaufgezogene Spendenaktion wurde vor ein paar Jahren ein ausrangiertes Marineschiff nach Palmerston gebracht und umgebaut. Es dient den stolzen Einwohnern als schnelle Verbindung nach Rarotonga, der Hauptinsel der Cook Inseln Auf Palmerston wird als erste Sprache englisch gesprochen, im Gegensatz zu den anderen Cook Inseln, wo das polynesische vorherrscht.
Als wir ins Haupthaus zurückkommen, ist eine reichhaltige Tafel mit Lamm, Fisch, Brotfrucht, Reis, Donughts (Berliner-Ringe) und vielem mehr gedeckt. Zu trinken gibt es kühlen, frischen Kokosnusssaft. Wir machen wohl einen sehr müden Eindruck auf Aka, sie drückt uns frisch bezogene Kissen, Decken und eine grosse Matte in die Hand und weist uns eine offene Hütte direkt vor dem Meer zum schlafen zu. So liegen wir angenehm im Schatten und verschlafen fast den ganzen Nachmittag, bevor wir wieder zum Essen eingeladen werden. In der Dämmerung fahren uns die Jungs zurück durch den schmalen Kanal zu unserem Ankerplatz ausserhalb des Riffs. Es ist für uns schon beruhigend, dass ihr Dingi angesichts der fast nicht sichtbaren, spitzen Korallenköpfe aus Aluminium besteht. Wir würden unser Dingi auf jeden Fall nicht riskieren. Man muss schon sehr ortskundig sein, um die richtigen Durchfahrt auch am Tag zu erwischen.
Der Buckelwal
Nachts um halb eins knallt es an unseren Schiffsrumpf. Andi springt vom Computer auf, ich aus dem Bett und wir rennen beide ins Cockpit. Will uns jemand entern? Knallte ein Schiff an die Muscat? Oder ein Baumstamm? Ich gucke über die Reling und sehe eine massige, riesige, weisse Fläche gleich neben dem Schiff? Was ist das bloss?
Ein Wal! Ein Wal liegt auf dem Rücken gleich neben der Muscat. Haben ihn unsere Twinkiele verführt, bzw. irregeführt? Er dreht sich um die eigene Achse, streckt eine Flosse in die Luft.
„Schnell hole den Fotoapparat!“
„Hol du ihn!“
Niemand will eine Sekunde dieses eindrücklichen Augenblickes missen. Andi schliesst den Scheinwerfer an und zündet zum Wal. Dieser taucht erschrocken ab. Etwa 5 Meter von Muscat entfernt, hebt sich ein langer Kopf ganz langsam 3 bis 4 m aus dem Wasser, sinkt genauso langsam wieder zurück ins Meer und staunt uns so im ganzen noch dreimal an. Oder wir ihn? Gerne würden wir noch näher und ausgiebiger bestaunen, doch er hat genug von uns und verschwindet in die Tiefe. Machs gut auf deiner weiten Reise, vielleicht sehen wir uns noch einmal auf dem Weg nach Neuseeland?!
Am nächsten Mittag holen uns die Marsters Jungs nach ihrer Fischjagd mit dem Aluminiumboot ab. Gestern Nacht waren sie noch Fliegende Fische im Scheinwerferlicht fangen, heute haben sie damit riesige Wahoos gefischt. Wir gucken ihnen zu, wie sie die Fische fein säuberlich zerlegen. Jede Familie hat 2-3 Tiefkühltruhen im Haus, die Fische werden sofort tiefgekühlt. Nach ihren Angaben sollen, wenn die Tiefkühltruhen voll sind, etwa 10 Tonnen Fisch gelagert sein, die sie regelmässig mit ihrem schnellen Marineboot „Marsters Dream“ nach Rarotonga fahren und dort verkaufen.
Ich versuche die verwandtschaftlichen Beziehungen im blauen Haus zu erforschen. Da ist Aka, die „Stammes“-Mutter. Viele ihrer Kinder sind nach Neuseeland oder Rarotonga ausgewandert. Ihre ca. 50jährige Tochter Sare ist vor Jahren aus Neuseeland zurückgekehrt. Ihr hatte es dort überhaupt nicht gefallen, sie fand es zu laut, unfreundlich und sehr hektisch. Sare zieht ihren 6jährigen Grossneffen J.J. auf. J.J. wurde Sare „geschenkt“, da sie beide am gleichen Tag Geburtstag haben. Ati ist vier Jahre alt. Ihre Eltern haben sie letztes Jahr auf der Insel bei ihren Verwandten zurückgelassen, als sie nach Rarotonga zogen. Ati wird von ihrer Tante betreut. Im ganzen gehören zur Familie des blauen Hauses zur Zeit etwa 15 – 20 Menschen, die sich als eine grosse Familie verstehen.
Sare ist für das leibliche Wohl der Familie verantwortlich, wobei ihr ihre Nichten in der Küche helfen. Sare öffnet z.B. viele grüne Kokosnüsse und sammelt den Saft im grossen Kanister, den sie in der Tiefkühltruhe kühlt. Sie kocht, bäckt, frittiert, richtet an und räumt alles wieder auf. Auch die Schweine wollen in ihren kleinen Gehegen gefüttert werden. Die jungen Frauen sitzen plaudern mit ihren Babies und Kleinkindern in ihren Hütten. Sie stellen zusammen Muschelketten her oder flechten neue Wände und Dächer aus Palmblätter für ihre Hütten. Aka unterricht unterdessen die Kinder Pearl, J.J. und Ati in lesen, schreiben und rechnen. Die Männer sind unterwegs am fischen oder reparieren und falls ein Schwein geschlachtet wird, ist das natürlich Männersache. Am Abend treffen sich alle Mitglieder der 3 Familienzweige auf dem Volleyballplatz, wo fleissig bis in die Dunkelheit gespielt wird. Und da wir jetzt ja auch zu einer Familie gehören spielt Andi fleissig mit. So hat jeder den Tag lang etwas zu tun. Das Leben geht viel gemächlicher vor sich, fast alles wird noch von Hand gemacht, kein Motorenlärm, kein Verkehr, kein Telefon, kein E-Mail, kein Fernsehen. Die Menschen, die hier leben, wollen ihr Atoll so bewahren wie es ist und nicht in der „verrückten“ Welt mitmischen. Die Familienmitglieder, die sich in die moderne Welt locken lassen, ziehen nach Rarotonga oder Neuseeland. Von dort unterstützen sie ihre Familie auf Palmerston.
Wie entfernt wir hier von der Welt sind, zu der wir eigentlich gehören, wird uns erst richtig am 11. September 2001 bewusst. An diesem Tag feiert Yanik seinen 5. Geburtstag. Für uns persönlich ist das natürlich ein freudiger, besonderer Tag. Nach den herzlichen Gratulationen und dem Öffnen des Geburtstagsgeschenkes, erkundige ich mich am frühen Morgen wie üblich nach dem Wohlergehen befreundeter Yachties auf hoher See. Die Verbindung ist ausserordentlich schlecht. Ich verstehe Stein von SY „Serenade“ kaum. Es gehe allen gut und sie kommen flott voran. Knapp nehme ich auf, dass die World Trade Center nicht mehr stehen!? Sofort schalten wir um auf die 5 Minuten-Nachrichten beim englischen Netz. Tatsächlich erfahren wir, dass die WTC durch einen Anschlag nicht mehr stehen und es Abertausende von Toten gegeben hätte. Die Welt steht kopf!! Und wir liegen im Südseeparadies und feiern abseits jeglicher Trauer, Elend und Hysterie Yaniks 5. Geburtstag auf unkomplizierte, schöne Art mit Spielen für die Kinder und Kuchenessen zusammen mit den Inselbewohnern und Johanna und Klaus Nölter von SY „Ole hoop“. Die Menschen auf Palmerston wissen nichts von der Katastrophe. Wir teilen den Menschen die Tragödie nicht mit, was und wen interessiert es hier wirklich? Wozu sollte diese Information nützlich sein? Uns selber kommt es irrsinnig, abstrakt und fremd vor, obwohl wir nur rudimentär informiert sind. Diese „verrückte“ Welt ist im Moment so fern von uns und hier, dass es sogar für uns schwer ist, das alles noch zu glauben.
Was kann man sich mehr wünschen, als auf der Paradies Insel von Palmerston als Gast zu verweilen, wenn die Welt Kopf steht?
Immer noch herrscht schönstes Segelwetter für die Weiterfahrt zum Zwergenstaat Niue, so nehmen wir trotz allem wieder einmal Abschied. Die Fahrt ist ruppig und rau. Die Wellen schlagen seitwärts an die Muscat, meist regelmässig, doch ab und zu knallt eine steile Welle hart an die Seitenwand und lässt unser Geschirr klirren und unsere schlecht verstauten Bücher und Spielsachen durch die Luft sausen.
Der Motor hat wieder Probleme beim Anspringen. Andi verschwindet für längere Zeit im Motorraum, diesmal mit Erfolg! Jetzt wissen wir definitiv, dass es das Minuskabel vom Motorblock zur Batterie ist. Immer wenn z.B. das Schiff fest schaukelt, ist dort der Kontakt nicht mehr konstant und der Motor startet nicht. Ersetzen können wir dieses sehr lange und dicke Kabel (50mm2) nicht und die richtige Kabelschuhgrösse haben wir nicht an Bord, so lassen wir vorläufig alles, wie es ist. Nun wissen wir wenigstens, wo genau der Wackelkontakt liegt und bei Wiederauftreten des Fehlers, können wir ihn beheben.
Ich bin froh und erleichtert als wir endlich die Leeseite von Niue erreichen, in Ruhe der steinigen Küste entlang segeln und an einer Ankerboje befestigen.
Niue
Hunderte von Kilometern von den nächsten Inseln entfernt, liegt Niue, ein selbstverwaltetes, aber eng mit Neuseeland verbundenes Eiland. Kapitän Cook versuchte 1774 dreimal auf Niue zu landen, doch wurden er durch die kriegerischen Einwohner erfolgreich vertrieben (Die Felsigen Küsten haben das Anlanden sicher schwer gemacht). Cook nannte Niue „Savage“ Island (Wilde Insel) im Gegensatz zu Tonga, das er „Friendly Island“ nannte. Das besondere an der Insel Niue ist, dass sich das Korallenatoll aus dem Meer erhoben hatte. Viele Höhlen (unter und über Wasser) gibt es zu erforschen, eine grüne Waldlandschaft auf Korallenblöcken zu erwandern und das Meerwasser soll nirgends sonst so klar sein, wie in Niue. Man kann tatsächlich am Ankerplatz bis zu 30 m tief auf den Grund sehen!
Wir kommen an einem Samstagmittag an, alle Lebensmittelläden sind hier schon geschlossen und am Sonntag ist hier absolute Sonntagsruhe angesagt. Offiziell wird gewünscht, dass niemand mit dem Dingi oder dem Auto herumfährt und jegliche Tätigkeiten sind zu unterlassen. Dieser Tag ist einzig und alleine dem Gottesdienst, den die Einheimischen mehrmals am Tage besuchen sowie der Ruhe gewidmet.
Früchte und Gemüse hatten wir zum letzten Mal in Aitutaki kaufen können. Wie gerne würden wir nach diesen Fahrten Frischgemüse essen! Dieser Wunsch scheint anderen „Yachties naheliegend. Unser „Nachbar“ hatte gutes Anglerglück, er bietet uns von seinem frischem Fisch und in Niue erhaltenem Gemüse und Früchte an. Eine weitere Yacht begrüsst uns und bringt noch mehr Gemüse. Doch zum Kochen kommen wir heute gar nicht mehr, denn wir werden für den Unterhaltungsabend in einem Hotel abgeholt und essen mit grossem Appetit an einem wunderbaren Buffett polynesischen Spezialitäten. Eine kleine Musikband spielt dazu live. Das tut uns richtig gut und gefällt uns sehr.
Übrigens ist für uns das Anlanden einfacher als für Cook war. Wir können am Beton-Anleger bei der Treppe aussteigen, Dinghi mit dem Handkranen die 3-4 m herausheben, auf einem Handwagen platzieren und auf einem Abstellplatz deponieren!
Tatsächlich ist am darauf folgenden Sonntag kein Mensch auf den Strassen zu sehen, sofern sie nicht singend die Kirche betreten oder verlassen, alles ist geschlossen! Das stört uns im Moment überhaupt nicht, denn Wale schwimmen den ganzen Sonntag und fast die ganze folgende Woche mitten durch unseren Ankerplatz. Eine Walfamilie schwimmt gemächlich durch die Bucht, bläst das Wasser in die Höhe, schwingt die Schwanzflosse hoch in die Luft und dies alles nur wenige Meter von uns entfernt. Wir sind überaus fasziniert. Andi zieht sich flugs das Schnorchelzeugs an, als ein Wal zwei Meter hinter der „Muscat“ durchschwimmt und begleitet sie einige Meter. Es scheint, dass unsere Kiele doch eine gewisse Anziehungskraft ausüben! Inzwischen kennen wir den Gesang der Wale, der gut in unserem Schiffsbauch hörbar ist. So wachen wir ab und zu nachts auf und hören dem Geschnatter und Gesang zu. Ich hätte nie gedacht, dass sich Wale so viel zu erzählen haben!
Den Montag verbringen wir vor allem im Supermarkt, um wieder einmal frisches Gemüse und Früchte zu kaufen und im Internet neues von zu Hause zu lesen. Seit Bora Bora ist es die erste Möglichkeit dazu. Ich unternehme im weltberühmten, glasklaren Wasser von Niue drei Tauchgänge in Unterwasserhöhlen. Wir mieten uns ein Auto und wollen diese kleine Insel in einem Tag erfahren. Doch welch ein Irrtum!
Klein, aber oho! Obwohl wir jetzt schon einige Insel-Landschaften hinter uns liegen haben, überrascht Niue mit seiner Andersartigkeit. Einen guten Anfang macht der Eiscremeshop mit ganz delikaten Eiscremes, die keiner italienischen Gelateria (oder jeder berühmten Glacemarke) nachstehen! Auf unserer Inselrundfahrt stoppen wir an gut bezeichneten Wanderwegen durch den grünen Tropenwald, steile Klippenformationen hinunter zu Höhlen und glasklaren Pools. Die Meerwasserpools entstehen bei Niedrigwasser. Es ist ideal in diesem ruhigen, geschützten Wasser mit den Kindern zu schnorcheln. Erstaunlicherweise wachsen dort die schönsten Korallenstöcke und es ist sehr fischreich.
Ungezogenerweise wirft Fabien seine leere Cola Büchse flugs in dieses Paradies. Ich schimpfe mit ihm und fordere ihn auf, die Büchse im seichten Wasser wieder zu holen. Er klettert emsig die Steintreppe hinunter in den Pool, während wir oben über die 2 m hohe Klippe zuschauen. Plötzlich sehe ich eine Moräne aus einer Höhe herausschlüpfen und die Büchse aggressiv anfauchen.
„Fabien, lass die Büchse und komm sofort wieder herauf“, rufen wir.
„Nein, ich gehe Büchse holen“, antwortet er gewissenhaft.
„Da hat es ein gefährlicher Fisch und du kommst sofort zu Mami und Papi“, insistieren wir.
„Nein!!“
Ich bin zum Sprung in den Pool bereit, als er auf unser erregtes, wiederholendes Insistieren endlich umkehrt. Zusammen foppen wir die Moräne noch mit Brotstücken, die sie natürlich verschmäht. Es ist einmalig, dass wir vom Trockenen aus den Kindern so einen schönen Einblick in die Unterwasserwelt geben können.
Auf meinem alleinigen, kleinen Rundgang am späteren Nachmittag sehe ich eine sehr giftige, schwarz-weisse Wasserschlange in einer Pfütze gefangen. Zum Glück ist ihr Maul zu klein, uns zu beissen. Sie faucht mich nichts desto trotz mutig an. Ich renne schnell zurück und hole meine Familie. Wie bin ich erstaunt, als ich zurückkomme und die Schlange mir über Land entgegenkriecht! Von wegen gefangen! Solche Wasserschlangen gibt es hier sehr viele, sind für uns aber gefahrlos. Andi und die Buben schnorcheln in diesem schönen Pool unter Steinbögen und Tunnels hindurch im glasklaren Wasser und sind hellauf begeistert von der Tiervielfalt. (Mir ist es zu kalt und ich fühle mich seit ein paar Tagen nicht so wohl.) Als es eindunkelt, haben wir erst etwa einen Drittel aller Sehenswürdigkeiten, wie die Höhlen, die Königsbäder, Felsarkaden, etc. gesehen.
Seit unserem Panamaaufenthalt im letzten April haben wir nun Tausende von Seemeilen mit der „Muscat“ hinter uns gebracht. Es reicht uns langsam aber sicher. Ich sehne mich danach, irgendwo wieder einmal länger und fest zu bleiben und bin wenig motiviert, die relativ kurze, nur 2 Tage lange Strecke bis zur Vava’u Gruppe im Königreich Tonga hinter mich zu bringen. Zudem bin ich viel öfters seekrank als vorher. Doch das gute Wetter will genutzt sein, es ist inzwischen nicht mehr selbstverständlich. Auf Grund der guten Wetterprognose segeln wir los.
Tonga
Das Königreich Tonga ist die einzige, sehr alte und heute noch existierende Monarchie in Polynesien. Als einziges polynesisches Land wurde Tonga nie von einer fremden Macht beherrscht. 700’000 Quadratkilometer gross ist dieses einzigartige Königreich, wovon nur 691 km2 Land ist. Dieses Land ist in vier grosse Inselgruppen aufgeteilt: Vava’u Gruppe im Norden mit ihren vielen einzigartigen geschützten Ankerplätzen (wurde übrigens am Neujahr 2002 vom Hurrican WAKA schwer beschädigt), Ha’apai Gruppe mit traumhaften weiten, weissen Sandstränden, Tongatapu im Süden mit dem Hauptort Nuku’alofa sowie der kleinen vulkanischen Inselgruppe Niuas im Norden, die wir nicht besucht haben. Hunderte von Seemeilen Meer liegen zwischen den Inselgruppen.
In Tonga ist die Erde sehr aktiv. Nur wenige Tage bevor wir in Tonga angekommen waren, war eine neue Insel aus dem Meer aufgetaucht. Hier ist es sehr wichtig, aktuelle Navigationsdaten zu benutzen, sonst passiert es leicht, dass eine Insel nicht mehr dort ist, wo sie sein sollte oder dass man plötzlich auf eine Sandbank auffährt, die vor kurzem noch nicht existiert hat!! Alle tonganischen Vulkane sind noch aktiv und in den letzten 200 Jahren ausgebrochen.
Vor etwa 3000 Jahren wurde Tonga von Fiji aus besiedelt. Die Tonganer waren immer gefürchtete Krieger und beeinflussten ganz Polynesien. Im 13. Jahrhundert gehörten zum Königreich noch Samoa, Niue, Wallis und Futuna und Tokelau! 1616 landeten die ersten Europäer (Holländer) bei den kannibalischen Tonganern. 1717 wurden die Schiffe von Kapitän Cook freundlich empfangen, bis heute werden die Insel „the friendly Islands“ genannt.
In Tonga gehört alles Land dem König. Jedem Mann steht ein kleines Stück Land zum bebauen und zur Ernährung seiner Familie zu. In dieser Hinsicht ist Tonga überbevölkert, denn mancher junge Mann muss heutzutage mangels Land auf sein Land warten. Land kann niemand in Tonga kaufen, es kann nur gepachtet werden. In Tonga wird vor allem Taro, Yamswurzeln, Maniok, Kürbisse, Bananen, Mango, Kokosnüsse etc. angepflanzt. Natürlich werden Schweine, Hühner und Hunde gehalten. Zunehmend wichtig ist der Tourismus, dazu geschäftet Tonga fleissig mit Satellitenplätzen (Geostationäre Satelliten über Tonga), Internetnamen mit der Erweiterung to für Tonga (z.B. tonic.to oder kickme.to) sowie Passport Verkauf an Hongkong Chinesen.
Tonga wird von den Adligen regiert, wobei der König absolut regieren kann. Gerade im November hat er das ganze Kabinett abgesetzt, nachdem Millionen von Dollars unerklärlich aus dem Staatsbesitz verschwunden waren. „Tonga, wo die Zukunft beginnt,“ heisst der Slogan. Übrigens hat Tonga kurz vor den grossen Milleniumfeiern in 1999 beschlossen die Sommerzeit einzuführen und mit diesem kleinen Kunstakt als erstes Land das Jahr 2000 gefeiert.
Vava’u Gruppe im Königreich Tonga
Mit Hilfe unseres Radars fahren wir am späten Abend des zweiten Fahrtages zwischen den ersten Inseln der Vava’u Gruppe hindurch und lassen den Anker auf Ankerplatz 6 fallen. Dank der detailreichen, übersichtlichen Handbücher von Moorings, die sich jeder Yachtie unterwegs irgendwo kopiert hat, sprechen jetzt alle nur noch von nummerierten Ankerplätzen, nicht mehr von Ortsnamen. So fährt man hier von Nummer 6 auf Nummer 7, von wo man einen netten Spaziergang auf Nummer 8 machen kann, u.s.w.
Zuerst müssen wir einklarieren. In Tonga herrschen striktere Regeln als auf den vorherigen Inseln in Bezug auf die Einfuhr von Frischwaren, Eier, Fleisch, Muscheln, Federn, etc. Um den im Hauptort Neiafu erwarteten Beamten zu beeindrucken, putzen wir die „Muscat“ auf Hochglanz und verstauen unsere Zwiebeln unter dem Bett, bevor wir durch den Inselkanal zum Hauptort Neiafu fahren. Wir legen am Einklarierungs-Dock an und warten brav 3 Stunden bis die Gesundheitsbehörde, der Zoll und der Immigrationsbeamte in ihren schwarzen Röcken und geflochtenen Matten um die Hüften uns besuchen. Formulare werden ausgefüllt, Limonade getrunken, ein schneller Blick ins Schiff, dass war es. Hier in Neiafu treffen sich fast alle Yachten wieder auf ihrem Weg nach Neuseeland. In den Bars geht abends die Post ab, vor allem am Regattaabend. Es gibt endlich wieder einmal frisches Gemüse und Früchte, Yoghurt, Käse und Fleisch zu kaufen, ja sogar dunkles Brot und Zopf beim österreichischen Bäcker, wie auch Salami und Räucherwaren vom deutschen Metzger. Das geniessen wir besonders. Am Sonntag herrscht hier grosse Ruhe, Jeder Tonganer besucht mehrere Male im Tag den Gottesdienst. Die meisten sein gläubige Methodisten und Mormonen, was sich vor allem bei den Mormonen sehr auszahlt, da sie grosszügig von ihren Glaubensbrüdern aus den USA unterstützt werden.
Nach schönen Tagen im Städtchen Neiafu, fahren wir zu den vielen, nahe liegenden Inseln. Die Vava’u Gruppe ist ein ideales, geschütztes und einfaches Segelrevier. Ein schöner Ankerplatz nach dem anderen kann in wenigen Minuten oder Stunden unter Segeln oder Motor erreicht werden. Mit dem Dingi erkunden wir riesige Höhlen, verweilen uns am Sandstrand oder spazieren in kleine Dörfer.
Nochmals lassen wir den Anker auf Nummer 6 vor einer kleinen, einsamen Insel fallen. Auf dem Weg zum Strand überrascht uns ein kräftiger Regenschauer. Noch grösser ist unsere Überraschung, als wir am Sandstrand von einer blonden Frau (was macht denn die hier?) begrüsst und willkommen geheissen werden. Zwei Angestellte bringen uns sofort Regenschirme.“ Bitte macht es euch im „Mala Resort gemütlich,“ meint die Dame.
Versteckt zwischen den Bäumen liegt eine kleine Hotelanlage, ganz im tonganischen Stil aus Bambusrohr und Palmenblättern mit kleinen Bungalows für die Gäste. Die blonde Dame und ihr Mann sind Amerikaner und führen seit ein paar Monaten dieses kleine Hotel. Alle Angestellten nicken uns freundlich zu und laden uns ins Haus ein. So freundlich wurden wir auf der ganzen Welt noch nie als Yachtie in einer Hotelanlage empfangen! Nach unserem Spaziergang um die kleine Insel, schwatzen wir mit Ron dem Hotelmanager. Er klagt uns seine Probleme mit dem Internet, über das er seine Hotelbuchungen und -bestätigungen abwickelt, aber schon seit einigen Wochen nicht funktioniert und keine Hilfe zu erwarten ist. Selbstverständlich bietet Andi seine Hilfe an. Dafür wiederum werden wir auf Hotelkosten zu einem tollen tonganischen Erlebnis eingeladen: eine Kava Party mit anschliessendem Erdofenschmaus, Musik und Tanz.
Am Dienstag Abend ist es soweit: Gespannt setzen wir uns mit den Hotelgästen in einen Kreis auf den Boden. Eine junge, anmutige Tonganerin rührt bedächtig in einem Plastikbecken das braune Kavapulver mit Wasser an. Junge Männer singen traditionelle, romantische Volks- und Liebeslieder. Dazu spielen sie Ukulele, auf einer verbeulten Blechschachtel Trommel und mit einer Holzkiste, an der eine Holzlatte mit einer Seilsaite befestigt ist, Bass. Die junge Frau reicht zwei kleine, mit Kava gefüllte Kokosnussschalen in die Runde. Sie wird von einem zum andern gereicht und muss anständigerweise in einem Zug geleert werden. Es schmeckt abscheulich. Yanik und Fabien schauen interessiert zu und ich frage mich, wie ich ihnen nachher erkläre, warum Mami und Papi aus dem Waschbecken das dreckige Wasser schlürfen. Ich bin froh, dass wir diese Zeremonie in diesem Hotel auf unkomplizierte Art erleben dürfen. Schon nach drei kleinen Schlücken würgt es mich und mir zu liebe sowie aus Furcht eine peinliche Situation herbei zu führen, lasse ich die weiteren Schalen an mir vorbei passieren. Es wäre denkbar unanständig gegenüber Gastgebern in Fidji einfach aufhören zu trinken ohne den Rauschzustand zu erreicht zu haben, was erst nach mehreren Litern dieses Getränkes eintritt. Meine Zunge und die Lippen fühlen sich für die nächsten Minuten leicht betäubt und pelzig an. Ich geniesse die wunderschöne Abendstimmung, die Musik und amüsiere mich über die verzerrten Gesichtsausdrücke der Gäste, die, wie es sich gehört, bis zum letzten Tropfen das Getränk „geniessen.
Der unverkennbare Duft vom angerichteten Erdofen-Buffet zieht durch unseren Kreis. Wir lassen es uns gut gehen. Lokale Tanzgruppen treten auf, zeigen ihren sehr ruhigen Tanz, bei dem durch Gesichtsausdruck, Finger-, Hand- und Fussbewegungen Geschichten vermittelt werden. Die gezeigten Kriegs- und Feuertänze sind so furchterregend, dass Yanik noch tagelang tief beeindruckt ist. Zum Abschluss tanzen alle 15 Gäste, inklusive Kinder mit den Tänzern und haben grossen Spass daran. Es gefällt uns so gut hier, dass wir zwei Wochen später nochmals an diesem schönen Abend teilnehmen. Mit unserer Begeisterung stecken wir diesmal einige Yachties an, so ergibt sich eine lustige Runde mit vielen bekannten Gesichtern.
Auf unserem Weg nach Neuseeland liegen jetzt noch die Ha’apai Gruppe und Tongatapu mit Nuku’alofa, dem Hauptort von Tonga. Eigentlich wäre es mir recht, direkt nach Nuku’alofa zu segeln und in Ruhe unsere grosse Überfahrt nach Neuseeland vorbereiten. Wir bereuen unseren Zwischenstopp in der Haapai Gruppe aber keinesfalls und erleben traumhafte Tage am schönsten Sandstrand unserer Reise in Polynesien. Mit uns liegen die zwei Schiffe „Orinoco“ aus Deutschland mit den Kindern Jonas (4 1/2) und Leon (3) sowie „Serenade“ mit dem Mädchen Sissel (4) vor Anker. Am frühen Morgen joggen Sabine und ich dem einsamen Sandstrand entlang um die Insel, später treffen wir uns alle zum Badeplausch, am Nachmittag geniessen wir Kaffe und Kuchen unter unserem Sonnendach am Sandstrand und am Abend zünden wir unser obligates, grosses Strandfeuer an und backen Stangenbrot. Unsere Idylle wird nach vier Tagen von angesagtem Schlechtwetter unterbrochen. Schon am späten Vormittag sind wir alle auf dem Weg nach Nuku’alofa.
Am nächsten Morgen nach einer ruhigen Segelnacht, etwa zwei Stunden vor dem Hafen Nuku’alofa machen wir bei Nieselregen die „Orinoco“ aus. Christian ist auf Wache. Unsere Wegpunkte sind gemäss Handbuch natürlich die selben, so kreuzen sich unsere Seewege. Ich muss schmunzeln als wir dicht hinter der Orinoco vorbeiziehen. Sabine kommt hoch, guckt sich um nach vorne, steuer- und backbord und übernimmt die Wache von Christian.
„Sabine hat uns so dicht hinter sich noch gar nicht bemerkt“, stelle ich fest, „jetzt musst du ihre Reaktion gucken, wenn sie mal zurückblickt und uns so nahe hinter sich sieht.“
Tatsächlich dreht sie sich um und erschrickt heftig. Erheitert winken wir ihr fröhlich zu. Seitlich vor der Hafeneinfahrt lässt die Orinoco zwischen anderen Schiffen den Anker fallen. Wir wundern uns darüber, dass sie nicht in den kleinen Hafen einfährt und entschliessen uns, es ihnen vorsichtshalber gleich zu tun. Beide winken uns zu und rufen uns über die Funke auf.
„Wir haben nicht genügend Diesel, um in den Hafen zu fahren, wir kommen später nach.“ „Ach so, ja dann, bis bald,“ lachen wir.
Nun das Wort „Hafen ist hier ja ein bisschen übertrieben. Eine Hafenmole lässt die Yachten ruhig im Hafenbecken liegen. Wir liegen vor Anker mit dem Heck zum Land mit zwei Heckleinen befestigt. Sanitäranlagen oder andere Einrichtungen gibt es nicht. Für umgerechnet 1 Euro fahren wir flott mit dem Taxi herum und machen unsere Besorgungen zur Vorbereitung unserer 1200 Seemeilen langen Fahrt nach Neuseeland.
Ich habe noch etwas anderes auf meinem Programm. Seit 11 Wochen bin ich schwanger, doch spüre ich, dass etwas nicht stimmt und lasse mir mit Hilfe des Trans Ocean Stützpunktes einen Arztbesuch vermitteln. Tatsächlich muss ein Abort vorgenommen werden. So rücke ich an einem Abend ins Spital ein, wo ich als Privatpatientin direkt vom Gynäkologen eingewiesen werde. Es ist mir ziemlich klar, dass ich auch als Privatpatientin nicht den tiefsten Schweizer Standard erwarten darf. Ein Bett mit Plastikmatratze und Plastikkopfkissen erwarten mich, ein wackliger Stuhl steht daneben. Die Farbe an den Wänden ist abgeblättert, mit undefinierbaren Flecken verziert. Mücken surren in Horden herum. Ich stehe neben dem Bett und warte bis es angezogen wird. Ach so, das ist schon fertig angezogen, ja dann. So lege ich mich auf das Plastik und werde von einer lieben, dicken Krankenschwester zugedeckt. Wie bin ich froh darüber, dass ich alle möglichen, evt. benötigten Dinge, wie Seife, Tücher, Papier, div. Hygieneartikel selbst mitgebracht habe. Es gibt hier nichts, ausser dem Bett und einem Lavabo in der Ecke, keine Handtücher, kein Abfalleimer, keine Seife, nichts was bei uns als selbstverständlich betrachtet wird. Von den Krankenschwestern und dem Arzt werde ich während den nächsten Stunden nett betreut. Ich verkrieche mich vorzugsweise unter dem mit alten Blutflecken „verzierten“ Bettlaken, um vor den vielen Stechmücken geschützt zu sein. Vor dem Fenster randalieren ein paar Jugendliche. Die Nacht wird lange und frustrierend, trotz den netten Schwestern.
Bis zum nächsten Morgen kann ich einen Toilettenbesuch hinauszögern. Schliesslich bleibt es mir nicht erspart, doch noch das Örtchen aufzusuchen. Auf dem Weg schiele ich in die anderen Zimmer. Sechs Mütter mit Babies liegen in einem Zimmer, der Boden, mangels Abfalleimern übersät mit Windeln, Hygieneartikel, Papier und manch anderem Unrat. Familienmitglieder treffen ein und bringen das Frühstück für die Patienten. Ich werde durch einen Lagerraum geführt, vorbei an Kisten am Boden stehend mit allerlei Verbandsmaterial gefüllt. Hinter einer knarrenden Holztüre befindet sich tatsächlich eine alte Toilette, aber natürlich ohne Lavabo. Die hygienischen Zustände sind unglaublich tief und wären meiner Ansicht mit wenig Einsatz und Mittel zu verbessern.
Zurück im Zimmer erhalte ich mit Butter bestrichene Brötchen und heissen Kakao, den die Schwestern wahrscheinlich von ihrem eigenen, mitgebrachten Frühstück abgezweigt haben. Für diese Nacht als Privatpatientin bezahle ich bei der Entlassung umgerechnet 12 Schweizer Franken. Nach gut einer Woche geht es mir wieder besser und so beschliessen wir trotz Einnahme von Antibiotika und Penizillin, nach Neuseeland loszufahren.
Abenteuerliche Überfahrt nach Neuseeland
Mit ungünstigem Wind legen wir an der Tankstelle „gleich um die Ecke“ an, um Diesel zu tanken. Hektik bricht aus, um ein Haar weht es uns in ein Fischerboot, aber alles geht gut. Wasser erhalten wir längsseits am Fischerboot. Wir befestigen die 18 Tonnen der Muscat an leichten Holzstangen des Fischerbootes und bekommen den Wasserschlauch herüber gereicht. Noch ein letztes Ankermanöver draussen an einer der vielen Inseln, wo wir die letzten Sachen aufklarieren, baden und am Strand laufen. Nach dem stärkenden Mittagessen fahren wir um zwei Uhr los. Der Wind ist ideal von achtern, wir kommen gut vorwärts. 1200 Seemeilen liegen vor uns, dazwischen ist nur noch das Minerva Riff.
Schon am nächsten Morgen haben wir ein technisches Problem. Die Hydraulikpumpe des Autopiloten setzt aus. Die See ist rollig, der Wind weht mit etwa 25 Knoten von achtern. Andi baut die Pumpe aus, während ich von Hand auf Kurs bleibe. Er reinigt sie, überprüft alles und baut sie wieder ein. „Hurra, die Pumpe funktioniert wieder“, wie sind wir froh. Es wäre furchtbar und fast unmöglich zu zweit 1200 Seemeilen durch dieses unbeständige Seegebiet nach Neuseeland von Hand zu steuern. Nur etwa 30 Segelstunden entfernt auf unserem Weg nach Neuseeland liegt das Minerva Riff, das einen geschützten Ankerplatz mitten im grossen Pazifik bietet. Das Riff liegt unter Wasser, doch die Lagune hat sehr guten Ankergrund und gilt als ziemlich sicher. Doch wie würde es von dort weiter gehen? Zurück gegen inzwischen 30 Knoten Wind und hohem Wellengang könnten wir nicht, bleibt noch der Halbwindkurs nach Fidji in etwa vier Tagen, was auch sehr mühsam wäre und uns sehr viel Zeit kosten würde, teils wegen dem Umweg, aber vor allem wegen der anliegenden Reparatur in Fidji. So sind wir wirklich sehr erleichtert, als die Pumpe wieder funktioniert. Andi legt sich wohlverdient in seine Koje und ich übernehme nachmittags um zwei Uhr die Wache.
Um drei Uhr steigt der Autopilot wieder aus! Andi ist gerade erst eingeschlafen, so entschliesse ich mich, vorläufig von Hand zu steuern, bis er wach ist und die Pumpe nochmals anschauen kann.
Die schlechte Nachricht nimmt Andi gelassen hin, baut in der rolligen See die Pumpe wieder kopfüber aus und versucht sie zu reparieren. Diesmal ohne Erfolg. Wir versuchen gegenan zurück nach Tonga „zu bolzen“, doch ausser der Steuerfrau sind Minuten später alle seekrank. Also doch nach Fidji auf Halbwindkurs? Wir beschliessen vorerst beizudrehen und den nächsten Morgen abzuwarten.
Doch leider bringt uns auch der nächste Morgen keine Änderung. Die Hydraulikpumpe arbeitet nicht mehr und dabei bleibt es. Inzwischen haben wir unser Leid auf der Funkrunde mitgeteilt. Es ist mir fast peinlich zu fragen, ob wohl zufälligerweise eine der 20 Yachten, die zur Zeit im Minerva Riff ankern, eine Hydraulikpumpe mit unseren Massen und Anschlüssen hätte. Wer hat schon eine teure Hydraulikpumpe, die dann auch noch passt auf Lager?!
Es ist unglaublich!!! Wir haben Erfolg! Tatsächlich meldet sich eine amerikanische Yacht, die irgendwo noch so ein Ding hätte. In ganz Polynesien wäre es wohl schwierig einen Ersatz zu erhalten, doch da hat es doch tatsächlich eine passende Hydraulikpumpe mitten im Pazifik. Alle zwei Stunden Ruderwache, so wechseln wir uns ab und segeln vor dem Wind 140 Seemeilen Richtung Minerva Riff. Es ist sehr anstrengend, unsere Augen und Köpfe fangen nachts an zu schmerzen vom angespannten Gucken auf den Kompass.
Am nächsten Nachmittag um vier Uhr versuche ich mit der Schweizer Yacht „Carlotta“, die vor Anker im Minerva Riff liegt, Kontakt zu erhalten. Es ist uns klar, dass wir nicht mehr bei Tagslicht einfahren können und wieder eine Nacht lang beigedreht abwarten müssen. Leider erhalte ich keine Antwort. Um sieben Uhr klappt es schliesslich mit der Verbindung, die Crew der „Carlotta“ konnten unseren ersten Aufruf um vier Uhr aufnehmen, doch hörten wir sie nicht. Auf jeden Fall wussten sie, dass wir in der Nähe sind und haben noch bei Tageslicht alle für die Einfahrt in das Riff wichtige Wegpunkte im GPS gespeichert und die Einfahrt ausgelotet!!
Mit Hilfe der irischen Yacht „Aldebaran“ und der „Carlotta“ und im vollsten Vertrauen zu ihnen, lassen wir uns bei stockdunkler Nacht per UKW-Funk und GPS Positionen lotsen. Das Wetter ist inzwischen schon ziemlich unfreundlich, ein starker Wind bläst, es ist stockdunkel. Urs von der „Carlotta“ und Pierre-Alain von der Schweizer Yacht „Merlin“ fahren im Regen bei Wellengang zum Riffeingang. Sie werden uns mit der Taschenlampe anleuchten, wir werden die „Muscat“ blind darauf zusteuern.
„Ja, also hier ist, glaube ich, die Einfahrt,“ hören wir Urs auf dem UKW sagen.
„Wie meinst du dass, Du glaubst, hier ist die Einfahrt,“ antworten wir.
„Es ist stockdunkel, wir können nichts ausmachen, aber die Tiefe deutet auf die Passage hin. OK, also fahr los, ruft er, zieht das Startkommando aber sofort wieder zurück. „Neeein warte noch einmal,“ ruft er, ändert nochmals seine Position, dann gibt er das Startsignal und leuchtet uns mit der Taschenlampe an.
Sind wir eigentlich verrückt, auf einen Taschenlampenstrahl bei stockdunkler Nacht im vollsten Vertrauen in andere Leute, loszufahren?? Wahrscheinlich schon. Andi hält einfach aufs Licht zu. Es brodelt und zischt um uns herum, ein Zeichen, dass wir uns in der Einfahrt befinden. Dann wird es ganz still. Wir haben es geschafft!!!!
Urs lotst uns zum Ankerplatz. Die See in der Lagune ist äusserst ruppig, trotzdem kommen Urs und Pierre-Alain auf ein feierliches Gläschen Wein zu uns.
Am nächsten Tag sucht die amerikanische Yacht „High Drama“ (das kann man wohl sagen) die versprochene Hydraulikpumpe heraus. Sie hat Zoll-Anschlüsse, wir metrische! Aber es ist ein kanadisches Produkt! Die Zoll-Anschlüsse lassen sich abschrauben, darunter findet Andi metrische, die genau auf unser System passen. Welch ein Glück wir haben!!! Jetzt muss die Pumpe nur noch funktionieren. Nach zwei Stunden hat Andi die neue Pumpe eingebaut und macht einen Test. Hurra, es funktioniert! Die Frage ist nun, ob die Pumpe auch unter Dauerbelastung so problemlos läuft. Da wir bei diesem Wind vor Anker schwojen, schaltet Andi den Autopilot ein. Der versucht munter, das Ruder entsprechend den Schiffsbewegungen hin und her zu drehen. Nach zwei Stunden Probelauf sind wir zufrieden und stellen das Ding ab. An das neue Geräusch der Pumpe müssen wir uns gewöhnen: sie tönt, als ob wir einen jungen Hund in die Bilge eingesperrt hätten, der jämmerlich um Gnade winselt. Was wohl die Immigrationsbeamten in Neuseeland dazu meinen werden?
Es ist kaum zu glauben. Den ganzen Tag über herrscht Starkwind und es regnet stark. Sicher und ruhig ankern wir im Minerva Riff und ersetzen die Pumpe.
Auch sonst herrscht trotz Starkwind und unfreundlichem Wetter Hochbetrieb im Minerva Riff. Es findet eine Hilfsaktion für drei Fischer in einem Sportboot statt, dass von einem Segelschiff auf hoher See treibend gefunden worden ist und auch ins Minerva Riff gelotst wurde. Die Sportfischer sind mit ihrem tollen Boot einfach in Fidji gestartet, ohne jegliche Kenntnisse von Navigation, Kompass lesen, GPS, Kartenmaterial, Essen und genügend Wasser. Sie werden mit UKW-Funk, GPS und Karten ausgerüstet. Alle Yachten geben von ihren Vorräten soviel sie können. Über SSB-Funk stellen die Helfer mit der Marine in Fidji Kontakt her und verlangen, dass diese Hilfe senden, sowie etliches nötiges Navigationsmaterial schicken…
Am nächsten Tag herrscht wieder wunderbares Wetter, als hätte es das Unwetter am Vortag nie gegeben. Kein Lüftchen weht und so bleibt es auch die nächsten Tage. Gemäss Prognose müssen wir im Schnitt 6 Knoten fahren, nur so schaffen wir es, vor dem nächsten Tief in den sicheren Hafen in Neuseeland einzufahren. Unser Kurs ist mehr westlich, falls wir ins Unwetter hinein kämen, könnten wir so besser Kurs halten und vor dem Wind nach Neuseeland ablaufen. Jeden Morgen hören wir die Entscheidungen und Positionen der vielen Yachten auf dem „Highway des Südens“, wie wir diese Strecke auf Grund der vielen Yachten nennen, auf der Funke mit.
Es ist immer noch absolut windstill, ich schneide die Haare der männlichen Crew, bevor sie ein kurzes Bad auf hoher See geniessen. Am zweitletzten Tag setzt der Wind ein, er weht jetzt gleich mit 30 bis 40 Knoten. Es geht los, die Front hat uns eingeholt. Über die Funke stellen wir fest, dass viele Yachten, die ungefähr auf unserer Höhe segelten, vor der Unwetterzone beigedreht haben und das Unwetter vorbei ziehen lassen wollen. Wir sind mitten drin, der Wind kommt achterlich, der Autopilot arbeitet sehr gut, es geht zügig vorwärts. Das Wetter ist kalt, grau und nass. „Muscat“ segelt ruhig und glatt durch die See. Nach 10 Tagen kommen wir gut in Opua im Norden von Neuseeland an.
Wir können sofort bei Zoll und Immigration anlegen, da wir die einzigen sind, die heute ankommen. Neuseeland ist für die sehr strengen Einfuhrregelungen bekannt. Grosse Listen von verbotenen Nahrungsmitteln und Gegenständen bekamen wir schon in Tonga in die Hände gedrückt. Nun, ich habe fast alle noch vorhandenen und nicht benötigten Nahrungsmittel dem Spital in Nuku’alofa geschenkt. Die Beamten staunen, wie leer es bei uns ist. Ich aber auch, als sie mir erklären, dass es eigentlich kein Problem gewesen wäre, alles einzuführen, sofern die Packung noch unversehrt ist. Dafür nehmen sie meine hilfreiche Aloe Vera Pflanze zur Verbrennung mit, die ich in Curacao geschenkt bekommen hatte. Da hatte ich die Information, dass es möglich ist, die Pflanze unter Umständen zu behalten. Ich bin ziemlich sauer, so drückt der Beamte bei unserem mitgebrachten Wein- und Rum-Quantum beide Augen zu . Na dann Prost, Rotwein soll ja auch gesund sein.
Übrigens war unser Entscheid durchzufahren ein weiser Entscheid. Die zurück gebliebenen Yachten erhielten „Wind auf die Nase“ und dies mit 10 Beaufort und hohem Seegang. Es sind alle wohlbehalten und gesund 2 bis 3 Tage nach uns eingetroffen.